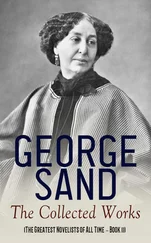Wunderbar ist die Stadt mit ihrem alten Kern in portugiesischem Kolonialstil, breit sind die Alleen durch die großen Palmenparks, im Verfall wird die vergangene Größe spürbar. In den Straßen am Hafen sieht man die helleren Nachfahren der Portugiesen. Gegen Abend ist die Stadt voller Störche, Pelikane, Reiher, Libellen, selbst Adler ziehen über dem angeschwollenen Fluss ihre Kreise. Gefühl völliger Verlassenheit. Noch nach fünf Jahren werde ich die Schuld nicht los, meine Mutter am Ende allein gelassen zu haben, sie in den letzten Jahren, als sie Bilanz gezogen hat, nicht genügend begleitet zu haben. Ich kämpfe mit den Tränen, kann sie einfach nicht gehen lassen. Mein Wecker ist auf den Steinboden gefallen, wie gut, dieses überflüssige Relikt beseitigen zu können.
An der gare routière bin ich schon früh Nummer 5 in einem alten Peugeot mit 7 Plätzen, kurz danach rasen wir mit beängstigendem Tempo durch den Regenwald mit Kapokbäumen, Mangobäumen schwer von Früchten, durch Reisfelder, auf denen Kinder und Jugendliche arbeiten, Richtung Elinkine im Mündungsdelta des Casamance, aufgehalten nur durch die Soldaten auf ihren Panzerwagen.
In Elinkine lädt mich der Diola Mamadou in sein selbst gebautes Impluviumhaus ein, ich bewundere die typische Bauweise. Durch den Versammlungsraum der großen runden Lehmhütte mit strohgedecktem Dach gelangt man in einen runden Innenhof. Das nach innen gewölbte Dach ist offen, das Regenwasser wird in ein Bassin gelenkt. Hier steht eine große Bananenstaude, die fast schon Dachhöhe erreicht hat, an ihrem Stamm spielen kleine Schildkröten. Um diese Öffnung herum führt ein durch Bambusträger abgestützter Rundgang, von dem die Räume abgehen. Beruhigend trommelt der Regen in das innere Becken, von dem aus ein Überlauf zum Brunnen draußen führt. So ist die erste Nacht in der Hängematte im Rundgang vor dem Regen sicher, und doch schlafe ich unter den Sternen, dicht über mir steht Orion.
Wegen des immer wieder aufflammenden Krieges haben sich viele Diola hierher an die Mündung des Casamance geflüchtet, so ist Elinkine, ein Bauerndorf mit wenigen Fischerfamilien, nun voller Fischer. Sie bringen viel zu viel Fisch, den sie auf großen Holzgerüsten zum Trocknen auslegen müssen, Haie, Rochen, Capitaines, Hechte. Die Lehm- und Strohhütten sind gegen die Waldtiere mit Bambuszäunen geschützt, überall laufen kleine dunkle Schweine herum, Ziegen und Schafe, zahllose kleine Kinder spielen im Sand zwischen den Tieren. Die Schwestern von Mamadou klagen ihr Leid, »Merkst du, wie das Dorf nun stinkt?« Auf dem Dorfplatz steht ein großes handgemaltes Schild: »Défense de chier«, Scheißen verboten, mit drastischer Zeichnung für die Analphabeten, die Choleragefahr ist allgegenwärtig.
Plötzlich lautes Geschrei, zwei gepanzerte Wagen mit Maschinengewehren und etwa 20 Soldaten kommen auf den Dorfplatz am Wasser gerast, verteilen sich überall, durchsuchen die Hütten nach Rebellen. Ich verstecke mich hinter einem Gebüsch, sehe die Möglichkeit, diese Szene zu fotografieren, vergesse den zugeschalteten Automatikblitz, bin sehr erschrocken. Kein Soldat hat den Funken gesehen, später macht mir Mamadous Familie heftige Vorwürfe, ich dürfe sie nicht gefährden, ich schäme mich sehr für meine Naivität. Als die Soldaten abfahren, klingen die Trommeln wieder, Frauen bringen die großen Obstkörbe unter den Mangobaum am Ufer, lachen und tanzen. Nebenan werden die Piroguen gebaut, im Rhythmus der Axtschläge feuern die Männer einander an, schwer ist die Arbeit an den meterdicken Stämmen.
Am Abend findet bei Mamadou eine große Versammlung statt, die Männer beraten, wie sie die Lage des Dorfes verbessern können. Sie gehen fair miteinander um, alle haben gleiches Rederecht. Da der Dialekt mit viel Französisch durchsetzt ist, verstehe ich eine Menge von den Problemen der Flüchtlinge.
Die Mückenplage am Wasser ist schlimm, zudem habe ich, sicherlich vom Brunnenwasser, nun schwere Durchfälle. Mamadous Impluviumhaus hat einen Toilettenanbau aus Lehm, in der Mitte des Raumes ist ein kleines Loch im Boden, darunter ist die Erde ausgehoben, eine kleine Plastikkanne mit Wasser steht neben dem Loch, Licht gibt es nicht, so sieht es denn dort aus und stinkt, wie es aussehen und stinken muss, ich stehe mit den Schuhen in der Scheiße, die Exkremente von Jahren bewegen sich, da sie ein intensives Leben von Ungeziefer enthalten, in kleinen Wellen. Mitten in der Nacht versuche ich, mit einem Eimer aus dem Brunnen Wasser zu schöpfen und das Schlimmste in eine Ecke zu spülen.
Der Weg in das Dorf Mlomp führt durch die Felder in den Regenwald, alte Kapokbäume umgeben den Ort, ihre Wurzeln greifen um sich wie die Schwänze riesiger Saurier, die spielenden Kinder verschwinden in ihren Windungen, eine urzeitliche Landschaft von brodelnder Fruchtbarkeit. Das kleine Krankenhaus St. Josephe wird von den Nonnen geführt, sie haben am Rande des Waldes große Schilder aufgestellt. Die Darstellung, wie jemand sein Bedürfnis im Wald erledigt, ist rot durchgestrichen, daneben sitzt jemand strahlend auf einer Toilette in einem Holzhäuschen, in großen Lettern die Warnung vor der Choleragefahr. Daneben der Hinweis auf die Zahnklinik mit dem drastischen Bild eines Zahnausreißers. Tief im Wald erreiche ich die Versuchsanstalt für Frauen in der Landwirtschaft, in langen Zügen kreuzen große rote Ameisen den Pfad. Lange muss ich am Rande der Piste auf eine Rückfahrmöglichkeit warten wie ein Kind sitze ich da und denke an meine Mutter, kämpfe wieder mit den Tränen, wie konnte sie mich nur verlassen.
Die Jungen, die in den Feldern am Straßenrand arbeiten, spielen Rebellen, jetzt haben sie die Straße mit Ästen blockiert und verschwinden im Busch. Bei Mamadou treffe ich Bamba, einen Offizier der Marinebasis, wir diskutieren über die Rolle der senegalesischen Armee, die laut Bamba völlig in die Bevölkerung, in Erziehungs- und Gesundheitswesen etwa, integriert ist, er leugnet jegliches Feindbild, aber Freundin Emilie und ich sind uns einig, dass sein Revolver nicht aus Kaugummi ist und wir keine Männer sein wollen. Dennoch lädt mich Bamba ein, das Haus seiner Mutter zu besuchen.
Am folgenden Vormittag treffen sich etwa 25 Männer des Ortes zum großen Freitagsgebet in der kleinen Moschee gegenüber, 50 Pantoffeln liegen im Matsch vor dem Eingang durcheinander, bunte Plastikkannen mit Wasser dienen der Reinigung, in einem Fensterrahmen liegen einige Bücher mit von der Feuchtigkeit aufgerollten Seiten, im Vorhof suhlen sich die schwarzen Schweine. Auch Mamadou geht beten, vorsichtshalber trägt er ein gris-gris, ein Amulett in Scarabäus-Form, um den Hals. Seine Frau schickt er zur Missionsstation nach Mlomp, man könne schließlich nie wissen. Als die Kinder krank waren, ist er selbst zur Kirche gegangen, auch zum bois sacré, dem Heiligen Wald, einer von all diesen Göttern werde immer helfen.
Die Marktfrauen fahren heute mit einer Pirogue zur Insel Karabane und nehmen mich mit, sehr herzlich ist der Abschied von Elinkine. Aus dem bolong fährt das Boot auf den Casamance hinaus, dessen anderes Ufer in der Regenzeit kaum zu erkennen ist. Uns begegnen in Einbäumen einzelne Fischer, die sich mit Kraft und Eleganz in der Strömung halten. Auf Karabane kann ich bei Amath im ›Barracuda‹ unterkommen, habe eine Hütte für mich, die in den tropisch wuchernden Blumen fast verschwindet, Wasser, eine Dusche, eine Toilette mit Spülung. Die Insel zu erobern bedarf des Kampfes durch die Vegetation mit einem starken Messer. Ich stoße auf eine fast verfallene bretonische Kirche, auf den von der ständigen Feuchtigkeit halb verrotteten Kirchenbänken ruhen sich die Ziegen aus. Bisweilen hält hier der Priester von Mlomp Gottesdienste ab. Ein Trampelpfad führt zu einem französischen Sklavenhaus des frühen 19. Jahrhunderts, einer ›école spéciale‹, in der unbotmäßige Sklaven durch Folter gefügig gemacht wurden, und zu den Ruinen einer portugiesischen Faktorei, vorbei an den kleinen Gehöften der Reisbauern, deren Felder im Süden der Insel liegen.
Читать дальше