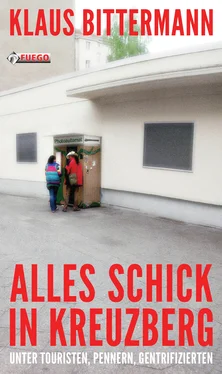Also stehen wir vor der Ampel. Die Leute um uns herum gehen bei grün über die Straße. Bei rot natürlich auch. Wir aber bleiben stehen wie zwei kleine Felsen in der Menschenbrandung. Dann fährt Fup unter der Hochbahn entlang, wo das Pflaster flächendeckend mit Taubenscheiße bedeckt ist. Er fährt weiter auf die Verkehrsinsel, inspiziert einen Sandhaufen und radelt dann weiter zu Kaiser’s durch die offene Tür zum Tresen der Backwarenabteilung, wo er sich von seinem Erziehungsbeauftragten eine Salzstange kaufen lässt.
Vor dem Eingang von Kaiser’s bleibt er stehen und isst. Direkt vor den Alkis. Zwei schreien sich an. Der eine sieht sehr derangiert aus, mit Bart, Augen auf Halbmast und einer verranzten Jacke. Der andere hat zu große Jeans an, und sein Gesicht befindet sich sehr nah vor dem Gesicht des anderen.
»Schon mal was von Distanz gehört? Ein bisschen mehr Distanz! Das ist ja wohl nicht zuviel verlangt«, sagt der bärtige Mann sehr sehr laut.
Der andere schreit zurück: »Scheiß Distanz, du weißt doch gar nicht, was das ist!«
Ein dritter stürzt herbei: »Jetzt seid doch mal nicht so laut.«
Fup guckt und mümmelt an seiner Salzstange. Der Schlichter gesellt sich zu einem Schwarzen mit Bierdose. Dann kommt er zurück und sagt: »Das Arschloch will mir sein Handy nicht geben. Ick muss ne ganz wichtige SMS verschicken. Is echt wichtig.« Und zu dem Schwarzen, der Biernachschub holt: »Fick doch deine Weiber.«
Fup guckt, isst und steht den Leuten im Weg. Ich auch. Wieder schreien sich die ersten beiden Alkis an. Es geht um das beschissene Leben im Allgemeinen. Der Schwarze ist wieder zurück. Der eine Schreihals schleicht sich von hinten an ihn ran und bewegt sein Becken vor und zurück.
Fup hat genug. Er fährt wieder nach Hause. Mit einer Hand. In der anderen hält er immer noch seine Salzstange.
Trotzki im gentrifizierten Bezirk
»Nein, da lang«, sagt Fup, und dagegen ist nichts zu machen. Dann eben da lang. Er läuft mit seinem Laufrad zur Admiralbrücke zu einer bestimmten Ecke. Dort ist ein Tapeziertisch aufgestellt, der mit einem roten Tuch geschmückt ist. Darauf steht schwarz »RSO«. Man sieht sofort, dass es sich um was Revolutionäres handelt, wegen der fetten Futuraschrift.
Hinter dem Tisch sitzen auf der Brückenmauer sechs junge Frauen unter zwanzig. Ein paar stehen daneben. Sie tragen, was junge Frauen in diesem Alter so tragen, und da es ein warmer Tag ist, nicht übermäßig viel. Die Garderobe ist bunt. Einige haben eine Sonnenbrille auf. Sie unterhalten sich. Niemand nimmt von mir Notiz. Oder von Fup.
Auf dem Tisch liegen Flugblätter mit einem roten Stern, auf denen »Gemeinsam kämpfen« steht. Es geht über die Berlinwahl 2011. 2011? Ist das nicht schon ein bisschen her? Hier werden also ein Jahr alte Flugblätter angeboten. Und Broschüren, die wahrscheinlich noch älter sind und »Kapitalistisches Elend und sozialistische Antworten« und »Grundsätze der RSO« heißen. Aber was heißt eigentlich RSO? Ich rate: »Revolutionäre Sozialistische Organisation«. Treffer. Na gut, war jetzt auch nicht wirklich schwer.
Die RSO steht, wie ich einem Faltblatt entnehmen kann, »in der Tradition der um Leo Trotzki formierten ›Linken Opposition‹ gegen den Stalinismus« und bezieht sich »positiv auf die russische Oktoberrevolution von 1917«, die »mit der stalinistischen Degeneration in den zwanziger Jahren gescheitert« ist.
Ich bin beeindruckt. Ein Hauch von hundert Jahre alter Geschichte umweht mich in einem fast vollständig durchgentrifizierten Bezirk mitten unter den Touristen, die alle ungefähr im gleichen Alter sind wie die Frauen hinter dem Tapetentisch, und die glücklich und zufrieden auf dem Pflaster der Brücke liegen und Pizza aus Pappschachteln essen.
Fup fährt den Kanal weiter an der Synagoge vorbei. Ein Ausflugsschiff kommt und Fup winkt. Die Leute auf dem Schiff winken zurück. Der Ausflugsschiffmoderator sagt gerade: »Und hier sehen sie einige Häuser, die abgerissen werden sollten. In den achtziger Jahren wurden sie dann besetzt und von den Besetzern instandgesetzt. Vielleicht war es ja ganz gut, dass es die Besetzer gab.« Die Besetzer gibt es nicht mehr, aber die Revolutionäre Sozialistische Organisation gibt es noch. Irgendetwas hat das bestimmt zu bedeuten, aber ich komme nicht drauf, was.
Bierflaschenverbot in Kreuzberg
1. Mai. Es ist schwül. Das ruft offenbar sehr widersprüchliche Gefühle hervor. Fup trifft eine Freundin, die gerade getauft worden ist. Gut, dass Fup nicht weiß, wovon die Rede ist, sonst würde er das auch wollen. Obwohl, wenn man ihm sagen würde, dass er da Wasser über den Kopf gekippt kriegt, wäre diese Sache schnell vom Tisch. Die Eltern wollen schnell nach Hause, um nicht in die Krawalle zu geraten.
Welche Krawalle? Das muss erforscht werden. Fups Freund Vico will auch mit, um »ein paar Steine zu schmeißen«. Sagt die Mutter, aber dann schläft er ein, und wir müssen allein losziehen.
In der Admiralstraße sagt ein Mann: »Das ist ja verantwortungslos mit dem kleinen Kind.«
»Ist es schon so schlimm?«, frage ich. Aber der Mann ist schon weiter.
Wir gehen die Skalitzer Straße lang. Hinter einem stabilen Eisengitter hat es sich eine türkische Familie auf Campingstühlen bequem gemacht, grillt und guckt das Spektakel, das ein wenig spannender ist als die Nachrichten heute, in denen fünf Minuten lang Leute zum Wetter auf Langeroog befragt wurden. Und fünf Minuten können sich ganz schön ziehen. Da ist man dann schon froh, wenn man wenigstens 1. Mai gucken kann.
Unter der Linie 1 paradieren viel zu warm angezogene Polizisten, während ihnen eine düsenjägerlaute Rockband im Weg steht. Nadja sagt jede Minute einmal: »Was für eine Freak-Show.« Manchmal auch öfter. Sehr viele junge Menschen sind unterwegs, in sehr unterschiedlicher Garderobe, mit proletarischem Schick, aber alle haben ein iPhone am Ohr und brüllen hinein, dass die Oranienstraße voll sei und dass sie gerade da sind, wo sie sind.

Auf der Wade einer dicken Frau bewundere ich ein Pin-Up-Tattoo. Immerhin mal ein Tattoo mit klaren Konturen. Meistens kriegt man gar nicht mehr raus, was das Tattoo überhaupt darstellen soll.
Alle tanken Bier aus Plastikbechern, denn es wurde ein Bierflaschenverbot über Kreuzberg verhängt, wie mir ein türkischer Bierverkäufer sagt, der mich ständig mit »Mein Herr« anredet.
In der Lausitzer Straße kommt uns eine Frau in einem langen schwarzen, sehr eleganten Abendkleid entgegen. Sie geht Richtung Reichenberger Straße. Sollte sie zur revolutionären 1. Mai-Demo gehen wollen, trägt sie jedenfalls nicht die vorgeschriebene Garderobe, denke ich.
Nach Einbruch der Dunkelheit um 22 Uhr 30 inspiziere ich noch einmal die Sachlage im ehemaligen Kreuzberg 36. Am Kottbusser Tor gegenüber vom »Südblock« steht eine Gruppe von zwanzig Polizisten in Kampfpanzern und in Schildkrötenformation. Sie stellen eine kleine Insel dar in einem Meer aus ziellos umherstreunenden Touristen, Partygängern, Schaulustigen wie ich, Großstadtnomaden und türkischen Familien. Die Türken bestaunen das Volk, wie man eben schräge Vögel bestaunt, die man sonst nur aus irgendwelchen TV-Dschungelcamps kennt. Auch die Polizisten in Schildkrötenformation werden bestaunt, aber da sie sich kaum bewegen, werden sie schnell uninteressant.
Vor dem »Südblock« sitzen die Leute und lassen es sich gutgehen. Und auch der türkische Imbiss mit Tischen davor ist bis auf den letzten Platz besetzt, also die Tische natürlich, nicht der Imbiss. Umzingelt von lauter eher gut gelaunten Menschen, könnte ich mir vorstellen, dass es den Polizisten mit der Zeit schwerfällt, den Feind zu identifizieren, oder an ihn ganz fest zu glauben. Kommt er heute noch? Oder ist er wo ganz woanders, der steinewerfende Chaot? Ich beneide die Polizisten nicht.
Читать дальше