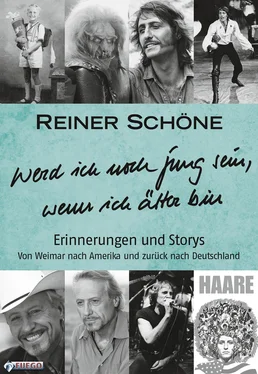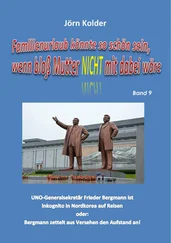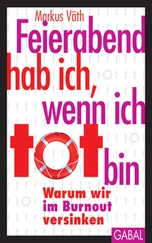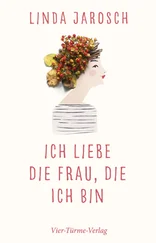Am nächsten Morgen im Theater ist das Erstaunen groß. »Wieso bist’n du zurückgekommen? Das hätt ich ja nie gedacht, wir haben eigentlich erwartet, dass du abhaust.«
Na wunderbar, das wird helfen, wieder eine Unbedenklichkeitserklärung von meinem Intedanten zu kriegen. Ein schönes Image hab ich da. Die Garderobiere E. sagt bitter: »Sie dürfen in Westberlin singen, und mich haben die noch nicht mal zur Beerdigung meiner Mutter rüber gelassen.« Jetzt fühl ich mich so richtig beschissen.
Zwei Wochen später sing ich mir im Leipziger Tonstudio die Seele aus’m Leibe. Die Rundfunk Big Band ist in Hochform, die Musicman-Arrangements klingen fett und rund, da hab ich was zum Einstieg im Westen. Noch vier Wochen bis zum 15. März.
Ich telefoniere vorsichtig rum, frage, wann kann ich denn die Kopien der Aufnahmen haben, bitte? Es dauert. Die haben’s ja nicht so eilig wie ich. Der Tag X rückt immer näher. Im Theater fangen die Proben an. Zu einem alten Broadwaymusical, »Can Can«. Wen soll das denn vom Hocker reißen!?
Ich bitte den Regisseur, mir nur eine kleine Rolle zu geben, dann ist der Hassel mit der Umbesetzung nicht so groß, wenn ich weg bin. Ich erfinde irgendeine Erklärung, ich hätte so viele Auftritte oder irgendwas. Die Kollegen wundern sich, als der Besetzungszettel am Schwarzen Brett hängt.
Ich werde immer hibbeliger, ich krieg diese fucking Music-Man-Bänder nicht. Der Auftrittstag kommt, wieder die alte Routine, ich hole meinen Tagespassierschein ab, fahre mit der S-Bahn nach Westberlin, null Uhr muss ich wieder zurück sein in Ostberlin - und 23 Uhr 30 bin ich zurück. Vor drei Tagen kam nämlich der dritte Gig in Westberlin, am 26. Mai. Die Notbremse.
Langsam wundert sich keiner mehr, ich gelte als sicher. Aber als ich im Funkhaus in der Nalepastraße über den Hof gehe, kommt mir Karl-Heinz O. entgegen. Der Musikredakteur.
Er kuckt mich an und spricht’s aus: »Du bist jetzt schon zweimal aus Westberlin zurückgekommen; ich trau dir nicht, du bereitest doch irgendwas vor.«
Da fällt’s einem schon schwer, cool zu bleiben. Ich sehe die Schrift an der Wand. Time to go! Time to say good-bye.
30. April. Nachts. Ich bremse auf den Basalt-Pflastersteinen im Berliner Norden; Lindenblütenstaub und Nieselregen machen die Straße glatt wie Schmierseife, der Wartburg bricht aus, schlingert, sägt eine junge Linde um, donnert in ein Gemüsegeschäft, schräg wieder raus und steht wie ‘ne Eins. Totalschaden.
Ich komme langsam zu mir. Vor drei Sekunden hab ich den berühmten Flash erlebt. Das war’s dann, this is the end, my friend. Und mir schoß durch’s Hirn: »Scheiße, jetzt krieg ich nie einen roten Mustang.«
5. Mai. Ich kriege eine Einladung vom Folksong-Festival auf der Burg Waldeck. Irgendwo an der Mosel, jedenfalls im Westen. Im Juni. Das ist ein internationales Liedermachertreffen, die wollen, dass ich meine Protestsongs singe, einen Workshop mache, das ist ein großes politisches Festival mit vielen Größen der Folkszene. Ich bin begeistert und stelle mein Konzept zusammen, schicke es dem Ministerium für Kultur - Klaus Gysi ist da der Chefminister - und kriege die lakonische Absage: »Wir sind an solchen Kontakten nicht interessiert.« Das war denen zu unkontrollierbar links.
19. Mai. Nach der Vorstellung »Der Musicman« (meine beste Rolle am Metropoltheater) steht ein Gentleman am Bühneneingang, ein eleganter Herr mit einem gepflegten Oberlippenbart. Er sieht aus wie ein Filmstar der UFA und spricht mich an: »Mein Name ist Kutschera, ich bin der Direktor des ‚Theaters an der Wien’.« Sein Wiener Akzent begeistert mich. Very charming.
»Ich hab Sie eben auf der Bühne gesehen, ich möchte Ihnen anbieten, ein Musical von Udo Jürgens in Wien zu spielen, ,Helden’, nach George Bernard Shaw. Glauben Sie, dass Sie nach Wien kommen dürfen?«
Halleluja, das isses! Da kann ich ja bisschen testen, ob’s mir im Westen überhaupt gefällt.
Der Wiener Theatermann gibt mir seine Telefonnummer, und am nächsten Morgen sitze ich meinem Chef im Büro gegenüber.
»Chef, ich hab da ‘n Angebot aus Wien, das würd ich gerne machen.«
Und was sagt mein Chef, der mich seit Jahren gefördert hat, zu dem ich ein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis habe? Er sagt den Satz, der die letzte Entscheidung nach sich zieht, der die Lawine auslöst, the Final Countdown. Er sagt: »In Wien spielen sie schlechtes Theater, bleib mal lieber hier, wir haben bessere Sachen mit dir vor.«
Über meinem Kopf wächst jetzt eine kleine Sprechblase, wie in einem Comic. »So, das wars. Dosvidanya DDR, jetzt hau ich ab!« Ich hoffe nur, dass sich mein Chef nicht noch an die Unbedenklichkeitserklärung erinnert, die er unterschrieben hat für meinen Gig in Westberlin. Nächsten Sonntag.
In einer Nacht- und Nebelaktion werden mir von einer Tonassistentin alle meine Rundfunkproduktionen überspielt. Auch die Leipziger Musicman-Produktion. Ich habe meine Bänder! Und sage Good-bye zu den zwei Freunden, denen ich traue.
Und dann kommt der härteste Abschied. Von meiner Freundin. Wir haben es drei Jahre lang gewusst, gefürchtet, hinausgezögert.
Zehn vor zwölf, am 26. Mai 1968, stehe ich in meiner Theater-Garderobe und lege meine Versicherungspapiere in meinen Schminktisch. Ich werde morgen meinem Chef aus Westberlin schreiben, er soll sich die zwölftausend Mark Vollkaskoversicherung abholen für meinen Autocrash und damit die Umbesetzungsproben bezahlen, die meine Flucht nach sich ziehen wird. (Wieso bin ich in dieser Situation so preußisch korrekt und bestelle mein Haus, bevor ich es verlasse?!)
Dann sag ich dem Pförtner ein langes Auf Wiedersehen - sonst ist kein Mensch im Theater an diesem Sonntag - und gehe zum Grenzübergang im Bahnhof Friedrichstraße. Das war’s dann. Es ist genau 12 Uhr Mittags. High Noon. Und mir zerspringt fast das Herz.
Der Gig im Reichsbahnausbesserungswerk Wannsee läuft wieder an mir vorbei. Jemand macht mich an wegen meiner pazifistischen Texte. Und ich denke mir, »Ich hab gerade den größten Schnitt meines Lebens gemacht. Wenn du wüsstest, wie egal mir deine Meinung ist, du Pfeife.«
Ich streife stundenlang in Westberlin umher, und dann melde ich mich bei der Polizei. Kantstraße/Ecke Fasanenstraße. Im ersten Stock. Auf’m Revier. Drei Polizisten tippen auf ihren Schreibmaschinen rum, als ich reinkomme, meine Gitarre rechts, eine kleine Tasche links. In der Tasche sind ein paar Kritiken, ein paar Fotos und die berüchtigten Musicman-Bänder. In meinem Hemdkragen stecken 200 Mark. Organisierte Westmark. Mein Startkapital.
Keiner nimmt mich wahr. Also noch mal von vorne: »Guten Abend, ich komme aus Ostberlin, ich möchte hierbleiben.« Das interessiert überhaupt keinen.
»Haaallo, ich bin gerade aus Ostberlin abgehauen!«
»Wir ham Sie schon verstanden, nehmse ma draußen Platz, wir rufen Sie dann auf.«
Wo bleibt der Champagner? Die Gratulationen? Nix. Ich hätte genausogut sagen können, »Ich hab ‘n paar Handschuhe verloren,« oder, »mein Kanarienvogel ist entflogen.« Die sind ja abgebrüht.
Nach der ernüchternden Protokollaufnahme fährt mich ein Wagen des Senats ins Flüchtlingslager Marienfelde. Mein Leben im Westen beginnt.
Nachtrag: Zwei Wochen später lande ich in München. Hans Beierlein, Udo Jürgens’ Manager, nimmt mich unter seine Fittiche, und ich unterschreibe einen Plattenvertrag mit BMG/Ariola. (Dank dieser verdammten Music-Man-Bänder. Siehste!)
Aber ich konnte nicht ahnen, dass ich ein Trauma, ein Fluchttrauma, mit mir durchs Leben schleppen würde. Über dreißig Jahre lang. Bis zu jenem 20. Oktober 1999.
Berlin, 13. August 2007
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Читать дальше