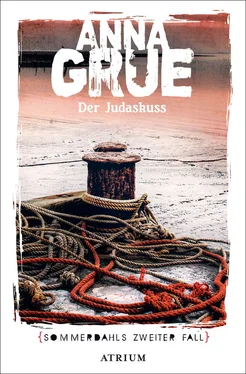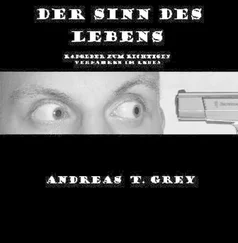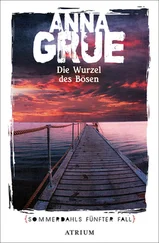Jakob hatte sie verlassen, und sie hatte gewusst, dass er es tun würde. Er hatte am Abend nicht, wie vereinbart, angerufen, er hatte weder sein Telefon abgenommen noch auf die vielen SMS reagiert, die Ursula ihm geschickt hatte. Sie hatte sich die Telefonnummer des Hotels herausgesucht und lange mit einer Frau an der Rezeption gesprochen. Es gab keinerlei Zweifel: Jakob hatte ein Einzelzimmer im Hotel Suisse reserviert, aber er war nie dort aufgetaucht. Als sie einen Mitarbeiter vom Kundenservice der Fluggesellschaft erreichte, bekam sie den endgültigen Beweis, dass etwas überhaupt nicht in Ordnung war. Jakob Heurlin und Einar Greiff-Johansen hatten zwar eingecheckt, sie waren jedoch nie am Gate erschienen. Das Flugzeug flog mit einer Viertelstunde Verspätung ohne sie nach Nizza.
Jakob war weg. Spurlos verschwunden. Als sie sich bei der Netbank einloggte, handelte es sich eigentlich nur noch um eine Formalität. Sie wusste genau, dass sämtliche Konten leer geräumt sein würden. Das Einzige, was er nicht angerührt hatte, war das Konto mit Anemones Geld, das ebenso weg gewesen wäre, wenn er auch dafür eine Vollmacht gehabt hätte. Alles andere war abgehoben. Die Ersparnisse, der Lottogewinn, sogar ihr Gehaltskonto und das Mastercard-Konto. Dazu natürlich Jakobs eigene Konten, auf deren Vollmacht sie in ihrer Naivität so stolz gewesen war.
Kurz hatte sie versucht, sich vom Weiterleben zu überzeugen. Sie hatte eine wunderbare, hübsche, fröhliche und talentierte Tochter. Sollte Anemone als Fünfundzwanzigjährige ohne Mutter sein? Sollten Ursulas Eltern ihr einziges Kind auf diese Weise verlieren? War sie nicht einfach nur egoistisch und verzogen? Sie hatte noch immer einen Job und eine Wohnung, wenn sie ihre Kündigung zurückzog. Vor ihr lagen noch zwölf, dreizehn Jahre, in denen sie arbeiten konnte. Es war möglich, neue Ersparnisse aufzubauen, einen neuen Traum zu finden, wie sie ihren dritten Lebensabschnitt verbringen wollte. Es gab Menschen, die ihr vertrauten, die sie mochten, die sie brauchten … Der Schmerz traf sie wie eine Keule. Sie hatte Wut, Schock, Demütigung und Selbsthass verspürt, doch es war ihr gelungen, den Schmerz fernzuhalten, solange sie sich darauf konzentrierte, sich Jakobs Betrug klarzumachen. Als sie irgendwann in ihrem engen Wohnzimmer saß, in dem nur der Computerbildschirm in der Dunkelheit leuchtete, übermannte sie der Schmerz, zog sie mit sich, drückte sie in das Polster ihres Sofas, quetschte Tränen, Rotz und lautes, jammerndes Geheul aus ihrem Körper. Da wusste sie, dass es hier nicht um einen Entschluss ihres rationalen Ichs ging. Sie konnte nur auf eine Weise reagieren, sie wollte fort, schlafen, verschwinden. Je länger, desto besser.
Im Medizinschrank fand sie die Resultate des zehnjährigen Machtkampfs zwischen ihr und ihrem praktischen Arzt. Als Ursula in die Wechseljahre kam, hatte sie mehrfach ihren Arzt aufgesucht, um nachts besser schlafen zu können und ihre Stimmungswechsel unter Kontrolle zu bekommen. Es sollte ihr ein wenig besser gehen. Die Antwort des Arztes bestand jedes Mal in einem Rezept, mal für das eine, mal für das andere beruhigende oder schlaffördernde Mittel. Imovane, Oxapax, Apozepam, Halcion … Jedes Mal war sie mit dem Rezept gehorsam zur Apotheke gegangen, hatte die vorgeschriebene Dosis ein, zwei Tage genommen, den tiefen, ungestörten Schlaf genossen … und den Rest der Tabletten in den Schrank gepackt. Es widersprach ganz einfach ihrer Mentalität, sich mit künstlichen Mitteln außer Gefecht zu setzen; es gefiel ihr nicht, dass sie derart die Kontrolle verlor. Aber es dauerte nicht lange, bis sie sich erschöpft vom Schlafmangel wieder zu ihrem Arzt schleppte und ein neues Rezept bekam – in der Hoffnung, dass das nächste Präparat nicht ganz so heftig anschlug wie das vorherige. Im Laufe der Jahre waren es sehr, sehr viele Tabletten geworden. Sie hatten sich in ihren neutral aussehenden Verpackungen auf dem obersten Regalbrett des Medizinschranks angehäuft und waren langsam, aber sicher verstaubt. Sie nahm die Schachteln heraus und legte sie auf ihren Schreibtisch, wo sie die Tabletten aus den Blisterhüllen drückte, bis schließlich ein beeindruckend großer, pastellfarbener Haufen vor ihr lag: Die weißen, rosafarbenen, lavendelblauen Tabletten leuchteten verführerisch.
Sie wollte drei Abschiedsbriefe hinterlassen: für Anemone, für Gitte … Sie schrieb, während sie den Haufen Tabletten schluckte. Jedes Mal, wenn sie eine Handvoll in den Mund steckte, spülte sie mit einem Rest des Orangensafts nach, den Jakob am Vortag gekauft, geöffnet und mit Wodka gemischt halb ausgetrunken hatte. Als sie begann, schläfrig zu werden, legte sie sich ins Schlafzimmer. Sie war beinahe bewusstlos, als sie anfing, sich zu übergeben, und damit die Wirkung der Medikamente verzögerte. Hätte ihr Magen den gesamten Inhalt bei sich behalten, wäre Gitte nicht rechtzeitig gekommen, um sie zu retten … aber dieses Detail wurde nie wieder erwähnt. Ebenso wie sich ihre Umgebung die meisten anderen Einzelheiten selbst zusammenreimen musste.
Merkwürdig, dachte Ursula jetzt. Sie hatte sich hundertprozentig darauf eingestellt, in jener Nacht zu sterben. Trotzdem war sie in gewisser Weise erleichtert, dass man sie rechtzeitig gefunden hatte. Der Instinkt, am Leben zu bleiben, war verblüffend. Schmerz und Kummer quälten sie noch immer, und wenn sie nicht Medikamente bekäme, hätte sie es möglicherweise sofort wieder versucht. Aber gerade in diesem Moment, mit ihren beiden Lieblingsfrauen an ihrer Seite – hatten sie etwa einen Wachtdienst eingerichtet? –, hatte sie das Gefühl, einigermaßen im Gleichgewicht zu sein. Und über eine Sache konnte sie sich zumindest freuen: Den Brief an ihre Eltern hatte man ungeöffnet und ungelesen in den Müll geworfen. Die beiden alten Menschen ahnten nicht, was passiert war, und würde es nach Ursula gehen, sollten sie es auch nie erfahren.
4 / Vormittag, Donnerstag, 22. März 2007
Dan Sommerdahl hatte sich von dem schönen Wetter locken lassen und war ein paar Kilometer länger als gewöhnlich gelaufen. Obwohl es in den Lungen brannte und die Oberschenkelmuskeln schmerzten, genoss er die Tour. Er war in einem ruhigen Tempo über die schmalen Waldwege gejoggt, zu hundert Prozent auf seine Atmung konzentriert, auf die Arbeit der Muskeln und auf seinen Pulsschlag, den er wie ein Brausen in seinem Körper spürte und der sich als blinkende, hellgrüne Zahl auf einem Pulszähler ablesen ließ, seinem neuesten Spielzeug. Dan war so auf das Training konzentriert, dass er kaum den Kopf drehte, während er an der Riesenvilla seines ehemaligen Chefs am Bøgebakken vorbeilief. Merkwürdiger Gedanke, dass es erst wenige Monate her war, seit sich ihre Wege getrennt hatten.
Als Dan die Aussichtsplattform erreichte, gönnte er sich wie gewöhnlich ein paar Minuten Pause und studierte seine Stadt von oben. Christianssund war eine klassische dänische Provinzstadt: vierunddreißigtausend Einwohner, hübsch an einem Fjord gelegen, eine Stunde Autofahrt bis zur Hauptstadt, eine düstere Domkirche aus dem 14. Jahrhundert, ein renommiertes Gymnasium, ein idyllisches Stadtzentrum mit Fachwerkhäusern und Stockrosen. In vielerlei Hinsicht war diese Provinzstadt also wie die meisten Provinzstädte. Aber von dem Aussichtspunkt hier oben würde ein scharfer Beobachter sehen, dass die Stadt auch ihre ganz besonderen Wahrzeichen hatte. Vor allem den Rathausmarkt, der mit seiner Platzierung unmittelbar am Hafen eine ganz andere Stimmung ausstrahlte als die meisten anderen Rathausplätze in Dänemark. Abgesehen vom Rathaus standen hier das Polizeipräsidium, ein Ärztehaus und das Hotel Marina. Von hier zog sich die Hauptschlagader der Stadt, die Algade, schnurgerade bis zum Bahnhof. Von jedem Punkt der leicht abschüssigen Einkaufsstraße aus konnte man den Fjord sehen, und an schönen Tagen herrschte im Stadtzentrum beinahe Urlaubsstimmung. Selbstverständlich hatte auch Christianssund seine Vororte, seine sozialen Wohnungsbauprojekte und falsch geplanten Shoppingcenter, doch das war alles leicht zu vergessen, wenn man von dieser Seite des Walds auf die Stadt blickte. Dan Sommerdahl wohnte mitten im attraktiven Herzen Christianssunds, in einem gelben Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert; es konnten Wochen und Monate vergehen, in denen er nicht in die Außenbezirke kam. Und man konnte kaum behaupten, dass er es vermisste.
Читать дальше