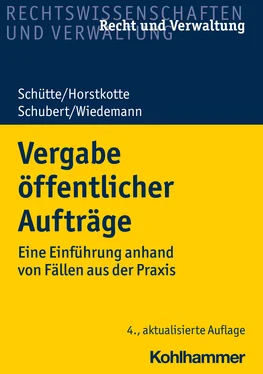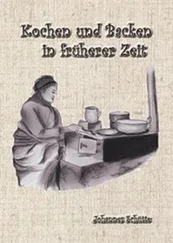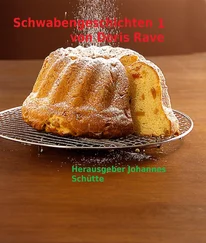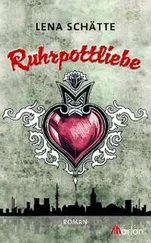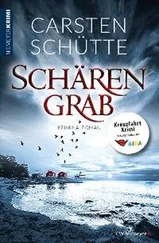d. Vergabe- und Vertragsordnungen.Die Vergabe- und Vertragsordnungen 47enthalten die detaillierten Regelungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Sie werden von Ausschüssen erarbeitet und verabschiedet, die aus Vertretern der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemeinden) und Vertretern der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zusammengesetzt sind. 48Die Vergabe- und Vertragsordnungen werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das betrifft einerseits die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, in dessen Teil A sämtliche Vergaberegeln – im Sinne einer konsolidierten Lesefassung auch die kraft GWB oder VgV ohnehin geltenden – versammelt sind. Während die Abschnitte 2 (EU) und 3 (VS) jeweils aufgrund der statischen Verweisung in der Vergabeverordnung bzw. in der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit die Rechtsqualität einer mit Außenwirkung versehenen Rechtsverordnung erhalten, da sie über diese Verweisung in den Verordnungstext inkorporiert werden, 49müssen der Abschnitt 1 der VOB/A und die UVgO für sog. Unterschwellenvergaben jeweils durch den Landesgesetzgeber gesondert in Kraft gesetzt werden.
aa) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).Die VOB gliedert sich in die Teile A, B und C, von denen nur Teil A das Vergaberecht regelt (VOB/A).Die VOB/A gliedert sich gegenwärtig in drei Abschnitte:
• Abschnitt 1regelt die Grundsätze der Vergabe von Bauleistungen sowie die einzelnen Verfahrensarten.
• Abschnitt 2(VOB/A-EU) enthält Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/24/EU.
• Abschnitt 3(VOB/A-VS) enthält Regelungen für die Vergabe von Leistungen im Anwendungsbereich der RL 2004/18/EG, d. h. in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung. 50
bb) Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) bzw. die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).Die VOL/A wurde 2017 auf Bundesebene durch die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) bzw. VgV ersetzt. Die VOL/A in ihrer Fassungvom 20.11.2009 erfasste (mit Ausnahme des Sektorenbereichs) alle Lieferungen und Leistungen, die nicht der VOB unterfielen. Sie war wie folgt untergliedert:
• Abschnitt 1:Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (abgelöst durch die UVgO),
• Abschnitt 2:Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/18/EG (abgelöst durch die VgV).
Für die Vergabe von Lieferungs- und Dienstleistungsaufträgen, die die von der EU vorgegebenen Schwellenwerte unterschreiten und daher nicht dem 4. Abschnitt des GWB unterfallen, gilt seit 2017 die Unterschwellenvergabeordnung. 51Neben den Grundsätzen der Auftragsvergabe, die in § 2 UVgO den für Aufträge oberhalb der Schwellenwerte geltenden Regelungen entsprechen 52, weist die UVgO auch mit dem Grundsatz der Vertraulichkeit (§ 3) und den Regelungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (§ 7) große Übereinstimmungen zum GWB-Vergaberecht auf. Folgelogisch ist auch das Vergabeverfahren diesem weitgehend nachgebildet.
e. Die Sektorenverordnung (SektVO).Die Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung vom 23.9.2009 (Sektorenverordnung – SektVO) ist am 29.9.2009 in Kraft getreten. 53Sie dient der Umsetzung der Sektorenrichtlinie 2004/17/EG (SKR) und sollte die zuvor in den Abschnitten 3 und 4 der VOB/A und der VOL/A enthaltenen Vergaberegeln vereinfachen und verschlanken. Die VgV enthält sich nunmehr jeglicher Bestimmungen zur Auftragsvergabe in den Sektoren. Damit stellt die SektVO einen Sonderbereich des Vergaberechtsfür Vergaben auf dem Gebiet der Wasser- und Energieversorgung und des Verkehrs dar.
Die SektVO ist in sieben Abschnitte gegliedert und folgt in ihrem Aufbau dem Ablauf des Vergabeverfahrens. Ihr Anwendungsbereichist § 1 SektVO zu entnehmen. Die Vorschrift knüpft an die in § 99 GWB genannten Auftraggeber an und gilt für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im Sektorenbereich. Bau- und Dienstleistungskonzessionen nimmt § 1 Abs. 1 Satz 3 SektVO aus dem Anwendungsbereich hingegen ausdrücklich aus. 54
Wichtig ist, dass die SektVO nicht nur für „Sektorenauftraggeber“ i. e. S. gilt, sondern für alle Auftraggeber nach § 99 GWB; das trägt dem Umstand Rechnung, dass es nicht vom Auftraggeber abhängt, ob das Sektorenvergaberecht zur Anwendung gelangt, sondern davon, dass der konkrete Auftrag der Durchführung einer Sektorentätigkeit dient. Umgekehrt unterfallen daher auch sog. Sektorenauftraggeber nicht mit allen Tätigkeiten dem Sektorenvergaberecht.
Die Verordnung gilt nach § 1 Abs. 2 nur für Aufträge, die die EU-Schwellenwertefür die Sektorentätigkeit 55erreichen oder überschreiten. Eine weitere Ausnahmeregelung enthält § 3 Abs. 1 SektVO: Danach fallen Aufträge, welche die Ausübung einer Sektorentätigkeit ermöglichen sollen, nicht unter die SektVO, wenn die Sektorentätigkeit auf Märkten mit freiem Zugang unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Ob das der Fall ist, obliegt der Feststellung durch die EU-Kommission (§ 3 Abs. 2 SektVO). Auch Auftraggeber können einen Antrag auf Freistellung stellen (§ 3 Abs. 4 SektVO).
Für den Bereich der öffentlichen Personenverkehrsdienste bildet die VO (EG) Nr. 1370/2007 eine wichtige Rechtsgrundlage, welche überwiegend beihilferechtliche, aber teilweise auch vergaberechtliche Regelungen enthält.
f. Die Vergabeordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV).Die VSVgV ist auf alle öffentlichen Auftraggeber i. S. d. RL 2004/18/EG anwendbar 56und regelt Vergaben in sicherheitsrelevanten Bereichen, d. h. zu militärischen, polizeilichen und geheimdienstlichen Zwecken. 57Sie kommt ausschließlich bei sog. „verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Aufträgen“ zum Einsatz. Ihr Anwendungsbereich ist damit auftragsbezogen definiert. Neben dem Militär, der Bundespolizei, der Polizei des Bundestages und dem Bundeskriminalamt müssen sich daher auch Auftraggeber auf Landes- und kommunaler Ebene (z. B. Kriminalpolizei, Ordnungsämter) an die Regelungen der VSVgV halten, wenn der Auftrag
• die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich dazu gehöriger Teile, Bauteile und Bausätze
• die Lieferung von Ausrüstung im Rahmen von Verschlusssachenaufträgen, einschließlich dazu gehöriger Teile, Bauteile und Bausätze
• Bau- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen
• anderweitige Bau- und Dienstleistungen für militärische Zwecke oder
• Bau- und Dienstleistungen im Rahmen von Verschlusssachenaufträgen
zum Gegenstand hat. Dem Auftraggeber steht hierbei ein Ermessensspielraum zu, ob der Auftrag eine oder mehrere der eben genannten Kriterien erfüllt. 58
Zweck dieser – restriktiv auszulegenden 59– Sonderregelung ist, eine Gefährdung wesentlicher Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik auszuschließen (§ 100 Abs. 6 GWB ). Denn in den o. g. Fällen könnte der Auftraggeber über eine Anwendung des klassischen Vergaberechts zu Auskünften gezwungen werden, deren Preisgabe wesentliche Sicherheitsinteressen i. S. v. Art. 346 Abs. 1 Buchst. a AEUV oder Staatsgeheimnisse i. S. v. Art. 346 Abs. 1 Buchst. b AEUV verletzen würde.
Die VSVgV weist weitere Besonderheiten gegenüber dem klassischen Vergaberecht aus . So können Auftraggeber nach § 11 VSVgV zwischen dem nicht offenen Verfahren, dem Verhandlungsverfahren und dem wettbewerblichen Dialog wählen, ein offenes Verfahren existiert nicht. § 6 VSVgV verpflichtet alle Beteiligten – auch auf Bieterseite und im Rechtsschutzverfahren – zur Vertraulichkeit. § 8 VSVgV sieht als weiteres Zuschlagskriterium ferner vor, dass der Bieter nicht nur die im Auftrag selbst enthaltenen Verpflichtungen erfüllt, sondern etwa auch auf unvorhergesehene Bedarfssteigerungen reagieren und über die gesetzliche Gewährleistung hinaus für eine Reparatur, Wartung oder Modifikation bereitstehen kann (sog. Versorgungssicherheit).
Читать дальше