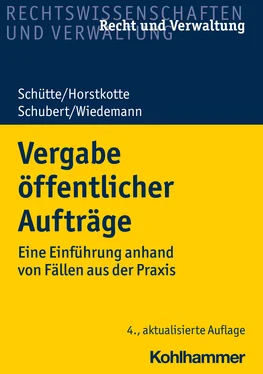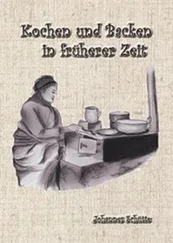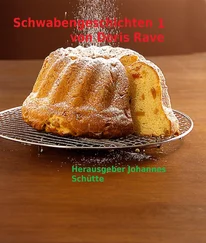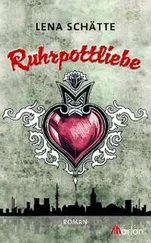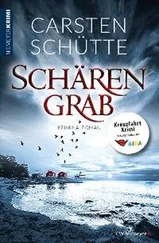Während lange Zeit der Grundsatz der Schriftlichkeit (vgl. zu den Anforderungen an die Schriftform § 126 BGB) für alle wesentlichen Elemente der Kommunikation galt, ist nunmehr in den Vergabeverfahren mit EU-weiter Ausschreibungspflicht die Kommunikation zwischen dem Auftraggeber bzw. der für ihn auftretenden Vergabestelle und den Teilnehmern am Vergabeverfahren grundsätzlich mit elektronischen Mitteln zu führen (§ 97 Abs. 5 GWB), d. h., dass der Auftraggeber alle Informationen elektronisch zur Verfügung stellen muss, z. B. die Auftragsbekanntmachung, die Vergabeunterlagen oder nachträgliche Bieterinformationen, dass die Teilnehmer alle wesentlichen Willenserklärungen innerhalb des Vergabeverfahrens, insbesondere Angebote und Teilnahmeanträge, elektronisch zu übermitteln haben und dass auch die Vorabinformation über die Nichtberücksichtigung des Angebotes oder der Zuschlag regelmäßig in elektronischer Form erteilt wird. Dabei legt der Auftraggeber jeweils fest, mit welchem Sicherheitsniveau die Kommunikation erfolgen soll.
Gleiches gilt grundsätzlich auch für die nationale Ausschreibung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nach der UVgO (vgl. § 7 UVgO); teilweise haben die Bundesländer eigene Übergangsregelungen für die zeitliche Umsetzung der eVergabe getroffen. Im Bereich nationaler Ausschreibungspflichten für Bauaufträge steht dem öffentlichen Auftraggeber derzeit noch ein Wahlrecht hinsichtlich der Art und Weise der Kommunikation zu (vgl. § 11 VOB/A). Je mehr sich jedoch die öffentliche Auftragsvergabe über elektronische Medien etabliert, desto geringer wird die Bedeutung dieses Wahlrechts in der Praxis werden.
Das Gebot der Gleichbehandlung und des fairen Wettbewerbs ist auch bei der Kommunikation zwischen Auftraggebern und Marktteilnehmern zu beachten. Der Auftraggeber muss den elektronischen Zugang zum Vergabeverfahren daher – abgesehen von begründeten Ausnahmefällen – so gestalten, dass sich auch Bieter ohne eigene IT-Abteilung an diesem beteiligen können. 30Daher stellt die Verwendung allgemein verfügbarer Kommunikationsmittel eine wesentliche Voraussetzung für einen diskriminierungsfreien Zugang zum Wettbewerb dar. Diese müssen auch sicherstellen, dass die Angebote und sonstigen rechtserheblichen Erklärungen der Bieter dem Auftraggeber bei rechtzeitiger Absendung fristgerecht zugehen. 31
Nach dem Grundsatz der Vertraulichkeit der übermittelten Daten muss der Auftraggeber bei der Mitteilung, dem Austausch und der Speicherung der Daten der Marktteilnehmer gewährleisten, dass die Inhalte der Angebote und der Teilnahmeanträge bis zum Ablauf der Eingangsfrist vertraulich bleiben und nicht von anderen z. B. Konkurrenten zur Kenntnis genommen werden können. Der Auftraggeber muss ferner sicherstellen, dass die Daten nicht durch Unbefugte verändert oder in anderer Weise manipuliert werden können.
• Die Integrität und Vertraulichkeit der Daten erfordert daher bei schriftlicher Übermittlung der Angebote oder Teilnahmeanträge die Verwendung eines verschlossenen und als Angebot bzw. Teilnahmeantrag gekennzeichneten Umschlages (bspw. § 38 Abs. 8 UVgO), auf dem ein Eingangsvermerk anzubringen ist und der bis zum Ablauf der Angebotsfrist unter Verschluss gehalten werden muss (bspw. § 39 Satz 2 UVgO).
• Erfolgt die Übermittlung auf dem elektronischen Wege d. h. in der Form des § 126b BGB bedarf es einer Verschlüsselung (vgl. § 7 Abs. 4 UVgO i. V. m. § 11 Abs. 2 VgV). Ferner sind zum Schutz der Informations- und Kommunikationstechnologie vor fremden Zugriffen geeignete organisatorische und technische Maßnahmen zu ergreifen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Überdies sind die Anforderungen des § 10 Abs. 1 Nrn. 1–7 VgV (z. B. Sicherstellung der Datenintegrität und Verschlüsselung) zu beachten. Hierbei muss der Aufraggeber allen Unternehmen eine diesen zugängliche Verschlüsselungsmethode für die Zusendung der Unterlagen vorgeben.
Bei einer Übermittlung der Angebote und Teilnahmeanträge per Telefax (vgl. § 38 Abs. 1 UVgO) dürfte nach den vorstehenden Grundsätzen ebenfalls eine Verschlüsselung gefordert werden.
IV.Rechtsgrundlagen des Vergaberechts
1.Überblick
Das Vergaberecht ist Gegenstand vielfältiger Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene. Entsprechend dem allgemeinen Rangverhältnis der Rechtsnormen finden sich auf höchster Stufe die Vorgaben des Europäischen Rechts, die die Ausgestaltung des nationalen Rechts prägen.
Hier ist zunächst der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)zu nennen. 32Die Normen des AEUV gehören zu dem sog. EU-Primärrecht und gelten in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar und ohne weitere Umsetzung. Gleiches gilt für Verordnungen der EU, z. B. zur Verwendung von Standardformularen für die Auftragsbekanntmachung oder für die Einheitliche Europäische Eignungserklärung oder über die Anpassung der sog. Schwellenwerte. Auf Grundlage des AEUV bzw. seines Vorgängers, des EG-Vertrages, sind die EU-Vergaberichtlinienerlassen worden. Die Richtlinien gehören zum sog. EU-Sekundärrecht, sie enthalten verbindliche Vorgaben für einen EU-weiten Mindeststandard, welcher von den Mitgliedsstaaten im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung eingehalten werden muss.
Der deutsche Gesetzgeber hat die EU-Vergaberichtlinien ins nationale Recht umgesetzt. Die grundsätzlichen Bestimmungen finden sich im Vierten Teil des GWB. Von dessen Ermächtigung, nähere Bestimmungen über das Vergabeverfahren durch Rechtsverordnung zu treffen, hat die Bundesregierung durch Erlass der Vergabeverordnung (VgV), der Sektorenverordnung (SektVO) und der Vergabeordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit (VSVgV)Gebrauch gemacht. Die Vergabeverordnung verweist ihrerseits wegen der Auftragsvergaben im Baubereich auf die Abschnitte 2 (EU) und 3 (VS) des Teils A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A ). Bei der Anwendung dieser Vorschriften sind wiederum zahlreiche landesrechtliche Regelungen zu beachten, die sich im Haushaltsrecht und den jeweiligen Vergabegesetzen der Länder, Erlassen und weiteren Rechtsquellen finden.
Das nationale Vergaberecht ist somit mehrstufigaufgebaut; für diesen Aufbau hat sich die Bezeichnung „Kaskadenprinzip “durchgesetzt. Zugleich ist es einer Zweiteilungin ein Vergaberecht für die Auftragsvergabe bei EU-weiter Ausschreibungspflicht und eines für die Vergabe bei nationaler Ausschreibungspflicht unterworfen; hierfür haben sich umgangssprachlich die Begriffe Oberschwellenvergabe und Unterschwellenvergabe eingebürgert.
Das europäische Recht bildet den Ausgangspunkt und den Rahmen des nationalen Vergaberechts. Gleich, ob es sich um EU-weit auszuschreibende Beschaffungen oder um nationale Verfahren handelt – stets sind die Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts (Transparenzgebot, fairer Wettbewerb) sowie die Vorschriften des AEUV zu beachten. Daher sollen zunächst die europäischen Grundlagen des Vergaberechts dargestellt werden.
a. Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist neben dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) einer der Gründungsverträge der Europäischen Union (EU). Er ist mit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabonam 1.12.2009 an die Stelle des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) getreten. Die europäischen Gründungsverträge werden als Primärrechtbezeichnet, da sie die Grundlage für den Erlass weiterer Rechtsnormen (Sekundärrecht) darstellen. Für das Vergaberecht sind neben dem Diskriminierungsverbot (Art. 18 AEUV) in erster Linie die Grundfreiheiten:
Читать дальше