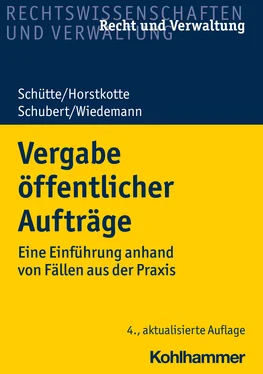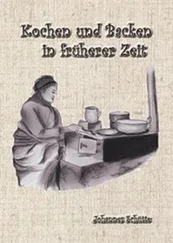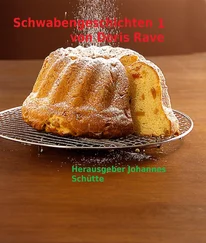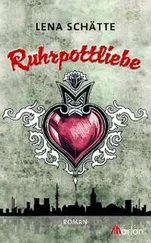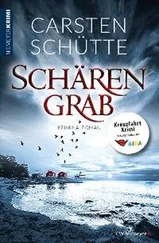Im Rahmen der Auftragsvergabe hat der Auftraggeber vornehmlich mittelständische Interessen zu berücksichtigen (§ 97 Abs. 3 GWB). Das kann insbesondere durch Teilung der Aufträge in Fach- und Teillosevollzogen werden 17, um auch kleinen und mittleren Unternehmen zu ermöglichen, an größeren Aufträgen zu partizipieren. Aufgrund dessen darf eine Losvergabe nur noch in begründeten – und aktenkundig zu begründenden – Ausnahmen unterbleiben. Grenzziehend wirkt das Gebot wirtschaftlicher Beschaffung: Eine Aufteilung des Gesamtauftrags in Fach- und Teillose hat nicht zu erfolgen, wenn sie in hohem Maße unwirtschaftlich oder eine einheitliche Gesamtleistung nicht mehr gewährleistet ist. 18Gleiches gilt, wenn die Aufteilung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand hergestellt werden kann 19oder die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen unmöglich gemacht wird. 20
Mittelständische Interessen sind darüber hinaus bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen, etwa im Rahmen der Eignungsprüfung. So dürfen keine Referenzen verlangt werden, die nur von größeren Unternehmen beigebracht werden können, für den konkreten Auftrag indes nicht erforderlich sind. Ebenso wenig darf der Auftraggeber Auswahlkriterien formulieren, die die Größe eines Unternehmens ohne Auftragsbezug als positives Differenzierungsmerkmal einführen. Dagegen darf aus § 97 Abs. 3 GWB nicht gefolgert werden, dass der Mittelstand bei der Auftragsvergabe gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz immer bevorzugt zu behandeln sei. Das Schlagwort lautet also: mittelstandsgerechte, nicht mittelstandsbevorzugende Vergabe. 21
5.Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes
Zahlreiche Vorschriften des Vergaberechts dienen der Beseitigung jeglicher Handelshemmnisseinnerhalb der Europäischen Union. EU-weite Ausschreibungen ohne Diskriminierung ausländischer Unternehmen setzen die Grundfreiheiten des AEUV – den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital – um und sollen damit einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung des europäischen Binnenmarkts leisten.
6.Das Gebot wirtschaftlicher Beschaffung
§ 97 Abs. 1 GWB unterstellt infolge dessen das deutsche Vergaberecht dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit. 22Es kommt daher nicht auf den niedrigsten Preis, sondern auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnisan.
Der öffentliche Auftraggeber soll dazu angehalten werden, nachhaltig zu beschaffen und dabei wie ein Marktteilnehmer zu handeln, der dem wirtschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt ist; er soll bei der Beschaffung unternehmerisch-rational, vorhersehbar und nachvollziehbar eigennützig „wie ein Privater“ handeln. 23Er folgt damit zugleich dem aus dem Haushaltsrecht stammenden Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Vergabe. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit erfordert ebenfalls eine effiziente Gestaltung des Vergabeverfahrens. 24So muss eine europaweite Ausschreibung erst ab bestimmten Auftragswerten erfolgen, während geringwertige Leistungen teilweise freihändig vergeben werden können. Der Umfang der erforderlichen Aufklärung der Angebote und der Prüfungstiefe von Angaben der Bieter hängt auch davon ab, bis zu welchem Maße dem Auftraggeber der Einsatz seiner zeitlichen, personellen und sachlichen Ressourcen für die Durchführung des konkreten Vergabeverfahrens möglich und zumutbar ist.
Der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verbietet auch im Vergaberecht die Ausübung von Rechten zu nicht vertragskonformen oder missbräuchlichen Zwecken. Er hindert den Auftraggeber daran, ohne rechtzeitige Ankündigung von seiner bisherigen Vergabepraxis (z. B. dessen Kriterien für die Vollständigkeit und Form von Angeboten) oder früheren Entscheidungen grundlos abzuweichen. Hat sich der Auftraggeber hinsichtlich des gleichen Vergabegegenstands dahingehend festgelegt, ob ein Bieter geeignet ist, muss er sich daran halten, kann bei anderen Losen oder Vergabeverfahren jedoch davon abweichen. 25
8.Beurteilungsspielraum und Ermessen
Dem Auftraggeber stehen in allen Phasen des Verfahrens eine Vielzahl von Entscheidungsspielräumen zu. Nach herrschender Meinung wird zwischen Beurteilungsspielräumen bei der Bewertung von Tatbestandsvoraussetzungen und Ermessensspielräumen bei der Auswahl der Rechtsfolgen unterschieden. 26Die Ausfüllung eines Beurteilungsspielraumes ist gerichtlich nur daraufhin nachprüfbar, ob sich der Auftraggeber an die gesetzlich vorgegebenen oder selbst bekannt gemachten Entscheidungskriterien gehalten hat, ob er von einer zutreffenden und vollständigen Ermittlung der für die Beurteilung maßgeblichen Tatsachen ausgegangen ist und ob er den ihm eingeräumten Entscheidungsspielraum in vertretbarer, sachbezogener und nicht willkürlicher Weise genutzt hat. Hierzu zählen beispielsweise die Feststellung des Vorliegens eines Ausschlussgrundes oder eines Grundes für die Aufhebung einer Ausschreibung, aber auch die Feststellungen für die Vergabe von Punkten im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote. Bei einem Ermessensspielraum unterliegt die Entscheidung des Auftraggebers der gerichtlichen Nachprüfung nur insoweit, dass der Auftraggeber deutlich macht, dass er sich bewusst ist, eine Ermessensentscheidung treffen zu müssen, dass er sich mit seiner Entscheidung in den Grenzen des ihm eingeräumten Ermessens bewegt und dass er seine Entscheidung auf sachbezogene, nicht diskriminierende und nicht willkürliche Erwägungen stützen kann. Die Nachprüfungsinstanz kann, von Ausnahmen einer sog. Ermessensreduzierung auf Null abgesehen, ihr Ermessen nicht an die Stelle des Ermessens des Auftraggebers setzen. 27Das betrifft Fragen wie die Aufteilung eines Auftrags in Lose bzw. die Auswahl und Gewichtung von Zuschlagskriterien 28und die Länge der Zuschlags- und Bindefristen bei der Vorbereitung der Ausschreibung oder den Ausschluss von Angeboten beim Vorliegen von fakultativen Ausschlussgründen, die Eignung der Bieter, die Wahl des wirtschaftlichsten Angebots, die Wertung zugelassener Nebenangebote 29. Teilweise ist der Ermessensspielraum stark beschränkt, z. B. bei der Wahl der Verfahrensart. Die Besonderheit des Vergabeverfahrens besteht in der Pflicht des Auftraggebers zur Veröffentlichung seiner Entscheidungsmaßstäbe zum Beginn des Verfahrens, so dass alle Teilnehmer am Vergabeverfahren (und auch eine Nachprüfungsinstanz) in gleicher Weise darüber informiert sind, welche Kriterien für die Beurteilung und die Auswahlentscheidungen maßgeblich sind. Die Auslegung der bekannt gemachten Entscheidungsmaßstäbe erfolgt nach den allgemeinen rechtlichen Regeln für die Auslegung von Willenserklärungen (§§ 133 und 157 BGB), also nach dem objektiven Empfängerhorizont. Das stellt hohe Anforderungen an die Formulierung der Entscheidungskriterien in der jeweiligen Bekanntmachung (Auftragsbekanntmachung oder Vergabeunterlagen).
Für die Vergabe von Bauaufträgen gelten weitere Grundsätze. § 2 Abs. 5 VOB/A normiert, dass die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundungunzulässig ist. Ferner soll nach § 2 Abs. 6 VOB/A der Auftraggeber erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertiggestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann (sog. Ausschreibungsreife). Überdies soll der Auftraggeber die Vergaben so gestalten, dass eine ganzjährige Bautätigkeit gefördert wird (§ 2 Abs. 7 VOB/A).
III.Anforderungen an die Kommunikation
Da öffentliche Vergaben besonders anfällig für Absprachen und andere Marktverzerrungen sind, hat sich der Gesetzgeber dazu entschlossen, besondere Erfordernisse für die Kommunikation zwischen Auftraggebern und Teilnehmern am Vergabeverfahren (Interessenten, Bewerber, Bieter) zu regeln.
Читать дальше