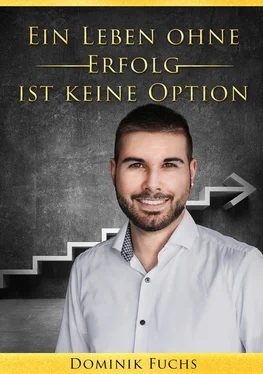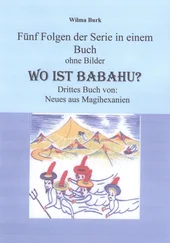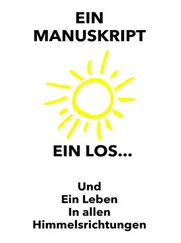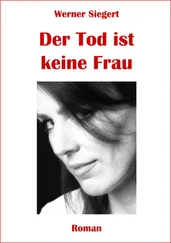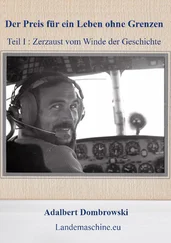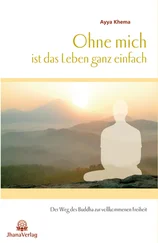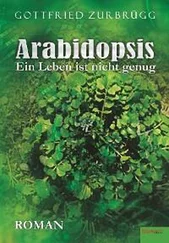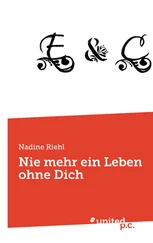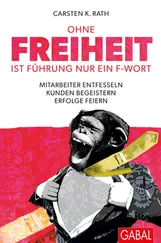Während Neugeborene jedoch nur über sehr wenige Denk-schemata verfügen, werden diese im Laufe der frühkindlichen Entwicklung schlagartig vermehrt. Diese Vermehrung erfolgt ganz einfach über Adaption und Organisation.
Die Organisation ist in diesem Fall nur das Zusammensetzen bestehender Denkschemata zu größeren und komplexeren Schemata. Die sogenannte Assimilation sorgt dafür, dass vorhandene Schemata und Strukturen an das eigene Vorgehen angepasst werden, wenn bereits ähnliche Erfahrungen vorliegen.
Das Gegenteil ist die Akkommodation, also die Erweiterung dieser Schemata, wenn die Erfahrungen noch nicht ausreichend vorhanden sind. Ein Kind strebt immer ein Gleichgewicht zwischen einer Assimilation und Akkommodation an, dies wird auch Äquilibrium genannt.
Ein gutes Beispiel an dieser Stelle ist ein Kleinkind, das etwas trinken möchte. In einem bereits adaptierten Schema ist das Kind in der Lage, eine Tasse zu greifen und im anderen aus einer zu trinken. Aus der Organisation heraus resultiert, dass das Kind die Tasse in die Hand nimmt und daraus trinkt.
Laut Piaget stehen Assimilation und Akkommodation im Gegensatz zueinander, sind aber beide unverzichtbar für die kognitive Entwicklung. Da sich die Umwelt regelmäßig ändert und wir uns entsprechend an die Umwelt anpassen, solltest du die Akkommodation und Adaption neuer Schemata niemals vernachlässigen.
Da ein Kind sich nur durch eine Auseinandersetzung mit der Umwelt aktiv entwickeln kann, ist eine Förderung und Anregung des Kindes für dessen Entwicklung von enormer Bedeutung. Obwohl der Drang zur Entwicklung laut Piaget vom Kind selbst kommt, ist es wichtig, eine möglichst konstruktive Umgebung zu schaffen, um sich mit der Umwelt auszutauschen.
Nachfolgend möchte ich auf die einzelnen Entwicklungsphasen, die immer fließend ineinander verlaufen, etwas näher eingehen. Danach erkläre ich dir wie du das Ganze für dich anwenden kannst.
Sensomotorische Phase (bis zum 2. Lebensjahr)
In den ersten beiden Lebensjahren sammelst du hauptsächlich Erfahrungen und lernst durch das Beobachten und Wahrnehmen. Im Mittelpunkt steht einzig und allein die Wahrnehmung von Objekten und was mit diesen gemacht werden kann. Du erkundest die Welt am Anfang noch mit deinen Sinnen und Bewegungen, in der Fachsprache wird das Ganze sensomotorisch genannt. Deine Intelligenz tritt zu diesem Zeitpunkt nur in Form von Reaktionen auf sensorische Reize sowie als motorische Aktivität in Erscheinung.
In der sensomotorischen Phase finden entscheidende Prozesse statt, die deine gesamte Grundlage der kognitiven Entwicklung ausmachen.
Als Neugeborenes übst du zuerst ausschließlich durch angeborene Reflexe. Danach geht es in die Phase über, in der Gegenstände ertastet, gegriffen und in den Mund genommen werden. Freud benennt diesen Lebensabschnitt in seinen Modellen sinngemäß die »orale« Phase.
Kurz darauf stellst du fest, dass Handlungen existieren. Du realisierst also nun, dass, wenn du etwas Bestimmtes tust, auch etwas Bestimmtes daraus resultiert. Zuerst passiert das rein zufällig. Mit der Zeit nimmst du aber aktiv Einfluss auf deine Umwelt.
Ungefähr ab dem achten Monat erkennst du, dass Dinge, auch wenn sie zurzeit nicht präsent sind, trotzdem vorhanden sind. In den darauffolgenden Monaten werden bereits bekannte Handlungen in fremden und neuen Situationen ausprobiert.
Ab dem ersten Lebensjahr werden bereits Experimente durch-geführt, also Handlungen in abgewandelter Form erneut ausprobiert und legen somit neue Schemata an.
Zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat bist du schon in der Lage, eine Handlung nachzuvollziehen und vorherzusagen. Ebenso ist eine gedankliche Auseinandersetzung mit einem Objekt, auch wenn es gerade nicht präsent ist, möglich.
Präoperationale Phase (2. bis 7. Lebensjahr)
Du lernst erstmalig durch Symbole, allen voran die menschliche Sprache, um mit deiner Umwelt zu kommunizieren und diese zu beeinflussen. Das bringt den Vorteil mit sich, dass du nicht zwingend nach etwas greifen musst, sondern auch darum bitten kannst. Das Objekt muss hierfür auch nicht unbedingt anwesend oder präsent sein. Trotz allem überwiegt in dieser Phase immer noch die sinnliche Wahrnehmung.
Konkretoperationale Phase (7. bis 12. Lebensjahr)
Hier entwickelt sich das logische und rationale Denken, jedoch stehen anschauliche Objekte immer noch im Vordergrund. Ebenso bist du erstmalig in der Lage, mehrere Gedanken- und Handlungsprozesse gleichzeitig zu erfassen und in Verbindung zu bringen. Ein vorausschauendes Denken und das Reflektieren deines eigenen Handels sind ab diesem Zeitpunkt möglich. Ein abstraktes Denken fällt dir aber immer noch sehr schwer. Zudem entstehen erste Wertehierarchien. Dies bedeutet, dass du deine Werte nach Wichtigkeit sortierst und priorisierst.
Formaloperative Phase (12. bis 15. Lebensjahr)
Nicht nur das abstrakte Denken, sondern hypothetisches Denken sowie Gedankenspiele sind ab sofort möglich. Dinge werden analysiert und von allen erdenklichen Seiten beleuchtet. Nun löst du dich auch endgültig von der reinen Wahrnehmung der Objekte und Situationen. Es steht also nicht mehr das Handeln, sondern das Denken selbst im Mittelpunkt.
Du bist kein Kleinkind mehr, das die Welt erkunden muss, also, was sollst du nun konkret mit diesem Wissen anfangen? Mit dem Alter hat das nichts zu tun, sondern mit der Vorgehensweise, die dieses Modell aussagt. Nämlich, dass du dich mit deiner Umwelt auseinandersetzen musst, um daran zu wachsen. Dafür musst du »Out of the box« denken und die verschiedenen Schemata zusammenführen, um etwas zu revolutionieren.
Wenn du also bereits älter als 15 Jahre bist, sollte das Denken für dich kein Problem mehr darstellen. Nur zuzuschauen ist also keine Option mehr. Setze dich stattdessen mit deinen Gedankengängen und Schemata auseinander und entwickle damit solche, die nicht mehr für einen Bewusstseinsfilter sorgen, der dich vom Erfolg abhält!
Kapitel 3.4: Blicke über den Tellerrand
Du brauchst mir jetzt auch gar nicht damit kommen, dass dein Körper und Geist Grenzen haben und du es deswegen nicht schaffst, dich weiterzuentwickeln. Es gibt zwar Grenzen, keine Frage, doch meist sind diese weit hinter deinem bisherigen Horizont oder deinen Erwartungen.
Die Psychiaterin Judith Bardwick beschreibt diese Grenzen als einen angstneutralen Verhaltenszustand, der durch deine eigene Psyche geschaffen wird. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder von einem Tellerrand gesprochen. Dieser Tellerrand soll deine individuellen geistigen Grenzen aufzeigen und kann in drei Teilbereiche, das sogenannte Drei-Sektoren-Modell, gegliedert werden.
Komfortzone
Die Komfortzone ist der bekannteste und am häufigsten von Motivationstrainern angesprochene Sektor. Das ist aus dem Grund so, weil in diesem Sektor alle Tätigkeiten, Orte und Personen eingeordnet werden, die dir bekannt und vertraut sind. Tätigkeiten, die dir so leichtfallen, dass du nicht einmal darüber nachdenken musst, Orte, die du blind besuchen könntest, und Personen, die hinter dir stehen, ohne auch nur den Ansatz einer Gegenwehr oder Diskussion lostreten zu wollen. Also alles, was dich in keiner Weise beeinträchtigen oder deinen Puls auch nur geringfügig anheben könnte.
Klar gibt es auch Tätigkeiten, die dir einfach im Blut liegen, aber das heißt nicht, dass du dich mit diesen isolieren und nichts Neues erlernen sollst. Genau aus diesem Grund wird die Komfortzone auch so oft kritisiert und davon gesprochen, dass man diese verlassen soll.
Wachstumszone
In der Wachstumszone trifft man auf das Phänomen, das ich bereits beim persönlichen Erfolg angesprochen habe, nämlich das Wachsen an Herausforderungen und die Weiterentwicklung, egal ob diese nun körperlich oder geistig ist. Diese Zone wird betreten, sobald du einen Schritt aus der Komfortzone heraus gewagt hast und dich deinen ersten Aufgaben mit weniger Sicherheitsgefühl widmest.
Читать дальше