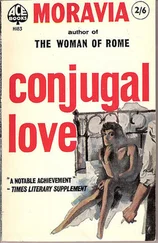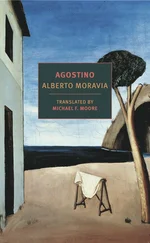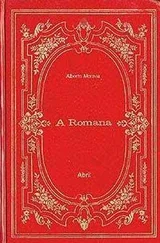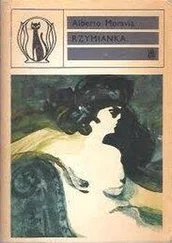1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Die ganze Klasse brach in Gelächter aus. Mit rotem Kopf kehrte Marcello in seine Bank zurück. Aber von diesem Tag an hörten die Hänseleien nicht etwa auf, sondern verdoppelten sich. Es war Marcello bei seinen Kameraden nur abträglich gewesen, daß er gepetzt und damit die stillschweigenden Regeln ihrer Kameradschaft gebrochen hatte.
Marcello begriff, daß er – um dem Spott ein Ende zu machen .– den Jungen beweisen mußte, wie wenig mädchenhaft er in Wirklichkeit war. Allerdings wußte er, daß es keinen Zweck haben würde, nur seine Muskeln vorzuzeigen, wenn auch der Lehrer dieser Meinung gewesen war. Um einen wirklichen Beweis zu erbringen, war etwas Ungewöhnliches erforderlich, was den Kameraden imponieren, was ihre Bewunderung wecken mußte. Was aber?
Ganz allgemein dachte er an eine Handlung oder einen Gegenstand, womit die Vorstellung von Kraft, Männlichkeit, wenn nicht gar Brutalität verbunden war. Er hatte gemerkt, daß die Kameraden einen gewissen Avanzini bewunderten, der ein Paar lederne Boxhandschuhe besaß. Avanzini, ein schmächtiger blonder Junge, konnte mit diesen Boxhandschuhen gar nicht umgehen. Trotzdem hatten sie ihm eine besondere Wertschätzung eingetragen. Ähnlich bewundert wurde auch ein gewisser Pugliese, der behauptete, einen unfehlbaren Griff der japanischen Ringkämpfertechnik zu kennen, mit dem man jeden Gegner fällen könne. Diesen Griff hatte zwar noch niemand gesehen, was die Jungen aber nicht hinderte, Pugliese ebenso zu bewundern wie Avanzini. Marcello begriff also, daß er sobald wie möglich einen Gegenstand wie die Boxhandschuhe herzeigen oder eine Fertigkeit wie diesen japanischen Ringergriff vortäuschen müsse. Zugleich aber war ihm klar, daß es sich um nichts Dilettantisches handeln dürfe wie bei Avanzini oder Pugliese. Er gehörte, wie er deutlich spürte, zu den Menschen, die das Leben und seine Verpflichtungen ernst nahmen. An Stelle von Avanzini hätte er seinem Gegner die Nase kaputtgeschlagen, an Stelle von Pugliese ihm den Hals gebrochen. Angesichts dieser beiden Jungen erfüllte ihn seine Unfähigkeit zu oberflächlicher Rhetorik mit einem unbestimmten Mißtrauen gegen sich selbst: Er wollte zwar den Kameraden einen Beweis für seine Kraft liefern – das schienen sie ja als Preis für ihre Achtung von ihm zu fordern –, hatte aber vor diesem Beweis irgendwie Angst.
Eines Tages bemerkte er, daß die Jungen, die ihn besonders eifrig zu hänseln pflegten, mehrmals untereinander tuschelten. Er glaubte ihren Blicken entnehmen zu müssen, es sei wieder ein neuer Streich gegen ihn geplant. Aber die Unterrichtsstunde verlief ohne jeden Zwischenfall. Als das Schlußzeichen ertönte, machte sich Marcello auf den Heimweg. Er blickte sich nicht um. Es war Anfang November, stürmisch, aber mild. Die letzte duftende Wärme des vergangenen Sommers schien sich mit der ersten, noch ungewissen Strenge des Herbstes zu vereinen. Marcello spürte eine dunkle Erregung. Es war ihm, als entwickle heute die Natur eine zerstörerische, mörderische Wut, nicht unähnlich der, die ihn selbst ein paar Monate zuvor veranlaßt hatte, Blumen zu köpfen und Eidechsen zu töten. Der Sommer war eine gleichmäßige, vollkommene Jahreszeit gewesen mit heiterem Himmel, dichtbelaubten Bäumen und Sträuchern voller Vögel. Jetzt sah Marcello mit Genuß, wie der Herbstwind diese Vollkommenheit zerriß, zerfetzte, wie er dunkle Wolken über den Himmel jagte, die Blätter von den Bäumen fegte und auf dem Boden in Wirbeln umhertrieb, wie er die Vögel verscheuchte, daß sie in schwarzen Schwärmen zwischen Blättern und Wolken das Weite suchten.
An einer Straßenecke bemerkte er, daß eine Gruppe von fünf Kameraden hinter ihm herging. Es war gar nicht zu bezweifeln, daß sie ihn verfolgten, denn zwei von ihnen wohnten in der entgegengesetzten Richtung. Doch in seine herbstlichen Empfindungen versunken, achtete Marcello zunächst nicht weiter darauf. Er hatte es nämlich eilig, zu der großen Platanenallee zu gelangen. Von dort führte eine Seitenstraße zum Hause seiner Eltern. In jener Allee, so wußte er, häuften sich die welken Blätter gelb und raschelnd auf den Gehsteigen, und im voraus genoß er das Vergnügen, mit beiden Füßen in diesen Herbstblättern herumzuwühlen.
Wie zum Spaß suchte er nun seine Verfolger abzuschütteln, indem er bald in ein Haustor trat, bald sich unter die Menge der übrigen Passanten mischte. Doch er mußte feststellen, daß ihn die fünf nach kurzem Suchen immer wieder fanden. Jetzt war die Allee schon ganz nahe. Marcello wollte sich nicht beim Spiel mit den welken Blättern beobachten lassen und beschloß daher, den Kameraden bereits vorher entgegenzutreten. Also wandte er sich um und fragte: »Warum geht ihr mir nach?«
Einer der fünf, ein Blonder mit scharfgeschnittenem Gesicht und kahlgeschorenem Kopf, antwortete prompt: »Wir gehen dir gar nicht nach. Die Straße ist doch für alle da, nicht?«
Marcello erwiderte nichts und setzte seinen Weg fort. Da war die Allee: zwei Reihen riesiger, kahler Platanen, dahinter die vielfenstrigen Häuser. Und da lagen auch die gelben, welken Blätter, in den Rinnsalen zu Haufen getürmt, auf dem schwarzen Asphalt verstreut, gelb wie Gold. Die fünf waren nicht mehr zu sehen, vielleicht hatten sie die Verfolgung aufgegeben. Marcello glaubte sich ganz allein in der breiten, menschenleeren Allee. Ohne Eile trat er nun mitten hinein in die Herbstblätter, schritt darin vorwärts und freute sich, daß seine Beine bis zu den Knien in der raschelnden Laubmasse versanken. Als er sich bückte, um eine Handvoll Blätter aufzuheben und in die Luft zu werfen, hörte er von neuem die spöttischen Stimmen: »Marcellina … Marcellina … zeig deine Höschen …!«
Da überkam ihn der beinahe wollüstige Wunsch, sich zu prügeln. Hochaufgerichtet ging er mit Entschiedenheit seinen Verfolgern entgegen und sagte: »Wollt ihr jetzt abhauen – ja oder nein?« Statt einer Antwort warfen sich alle fünf auf ihn. Marcello hatte irgendwie gehofft, so kämpfen zu können wie die Horatier und die Kuriatier in der Legende. Hin und her laufend wollte er bald den einen, bald den anderen mit einem kräftigen Schlag erledigen und sie so alle zusammen dahin bringen, von ihm abzulassen. Das aber war, wie er sofort merkte, unausführbar. Die fünf hatten sich in weiser Voraussicht gleichzeitig auf ihn gestürzt, einer hielt ihn an den Armen, ein anderer an den Beinen fest, zwei hingen um seine Leibesmitte. Der fünfte jedoch, wie Marcello sah, öffnete hastig ein Paket. Dem entnahm er ein Kinderröckchen aus blauem Kattun.
Alle lachten jetzt, während sie ihn eisern festhielten. Der mit dem Röckchen in der Hand sagte: »Komm, Marcellina, wehr dich nicht. Wir ziehen dir nur das Röckchen an und lassen dich dann zu Mutti laufen.«
Das war genau der Scherz, den Marcello befürchtet hatte. Mit purpurrotem Kopf schlug er wütend um sich, aber die fünf zusammen waren natürlich stärker als er. Zwar gelang es ihm, einem das Gesicht zu zerkratzen, einem anderen einen Fausthieb in den Magen zu versetzen; aber er spürte doch, wie seine Bewegungsfreiheit immer weiter eingeengt wurde. »Laßt mich … ihr Idioten! Laßt … mich …!« stöhnte er. Daraufhin stießen seine Peiniger ein Triumphgeschrei aus, denn das Röckchen glitt über Marcellos Kopf. Seine Proteste verloren sich wie in einer Art Sack. Er strampelte ohne Erfolg. Geschickt schoben die Jungen den Rock immer weiter herunter, bis er auf den Hüften saß. Dann spürte Marcello, wie sie in seinem Rücken die Bänder knoteten.
Auf einmal hörte er eine ruhige Männerstimme, die mehr neugierig als vorwurfsvoll fragte: »Darf man wissen, was ihr da treibt?« Sogleich ließen die fünf von Marcello ab und liefen davon. Er fand sich plötzlich allein – noch keuchend und blutrot im Gesicht, den Rock fest um die Hüften gebunden. Er hob den Blick und sah vor sich den Mann stehen, der die Kameraden vertrieben hatte. Der Unbekannte trug eine dunkelgraue Uniform mit hochgeschlossenem Kragen, war bleich und hager, hatte tiefliegende Augen, eine große traurige Nase, einen verächtlichen Ausdruck um den Mund und Haare im Bürstenschnitt. Auf den ersten Blick wirkte er beinahe übertrieben streng, dann aber entdeckte Marcello einige Züge an diesem Fremden, die alles andere als streng waren: etwas Weiches, Verlebtes in den Mundwinkeln, eine Unsicherheit der ganzen Haltung.
Читать дальше