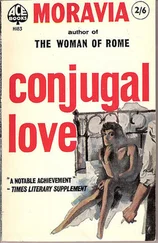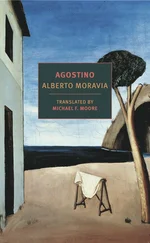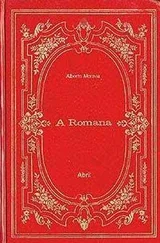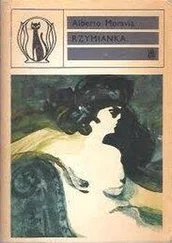Verschüchtert und verschreckt baute er jetzt in aller Eile ein glaubhaftes Lügengebäude auf: Nicht er hatte die Katze getötet, sondern Roberto. Die Katze befand sich ja in Robertos Garten. Wie hätte er sie über die Mauer hinweg, durch den Efeu hindurch, töten können? Dann aber fiel ihm plötzlich ein, daß er ja am Abend zuvor selbst seiner Mutter die Tötung einer Katze gestanden hatte. Er erkannte, daß ihm der Ausweg der Lüge verschlossen war. Wahrscheinlich hatte die Mutter trotz ihrer Zerstreutheit dem Vater sein Geständnis wiedererzählt. Und dann hatte dieser zwischen dem Geständnis und den Anschuldigungen Robertos einen Zusammenhang hergestellt. Da gab es nun keinerlei Ausrede.
An diesem Punkt schlugen Marcellos Gedanken wieder um.
Heftig wünschte er aufs neue eine rasche und entscheidende Strafe herbei. Doch was für eine Strafe? Er erinnerte sich: Roberto hatte eines Tages von Instituten gesprochen, wohin Eltern ihre mißratenen Söhne zur Strafe schickten. Zu seiner eigenen Überraschung wünschte er jetzt, zur Strafe in ein solches Institut geschickt zu werden. In diesem Wunsch kam unbewußt der Widerwille gegen das ungeordnete Familienleben zum Ausdruck. Er ließ ihn das herbeiwünschen, was die Eltern für eine Strafe hielten. Er betrog sich selbst mit der schlauen Berechnung, in so einem Institut seine Reue beschwichtigen und vielleicht sogar sein Schicksal ändern zu können.
Diese Gedankenkette führte ihn zu einigen Phantasiebildern, die zwar beängstigend wirkten, aber zugleich auch angenehm waren: ein strenges, kaltes, graues Gebäude mit vergitterten Fenstern. Eisige, schmucklose Schlafsäle mit Reihen von Betten und hohen, weißgekalkten Wänden. Freudlose Klassenzimmer voller Bänke, vorn ein Katheder. Nackte Korridore, finstere Treppen, massive Türen, unpassierbare Gitter. Alles – mit einem Wort – wie im Gefängnis! Und doch zog Marcello so ein Institut der haltlosen, beängstigenden, unerträglichen Freiheit des Elternhauses vor. Sogar der Gedanke, in einer gestreiften Uniform zu stecken und mit rasiertem Kopf umherzugehen, wie das jene Internatszöglinge taten, die er bisweilen auf der Straße vorbeimarschieren gesehen hatte, sogar diese demütigende und beinahe ekelerregende Vorstellung war ihm jetzt willkommen. Denn er sehnte sich verzweifelt nach irgendeiner Norm und Ordnung.
Während er solchen Phantasien nachging, sah er nicht seinen Vater an, sondern hielt den Blick auf das blendendweiße Tischtuch geheftet. Dann und wann fielen Insekten darauf, die am Lampenschirm abgeprallt waren. Einmal hob er die Augen. Da sah er hinter seinem Vater auf dem Fensterbrett das Profil einer Katze auftauchen. Ehe er jedoch ihre Farbe ausmachen konnte, war sie bereits heruntergesprungen. Sie durchquerte das Speisezimmer und verschwand in Richtung Küche. Obzwar Marcello seiner Sache keineswegs sicher war, weitete sich sein Herz doch bei dem freudigen Gedanken, dies sei die Katze, die er wenige Stunden vorher im Garten Robertos liegen gesehen hatte. Allein die Hoffnung, sie könne es sein, befriedigte ihn. War es nicht ein Beweis dafür, daß ihm das Schicksal dieser Katze näherstand als sein eigenes?
»Die Katze!« rief er laut. Dann warf er die Serviette auf den Tisch, schob ein Bein vor und fragte: »Ich bin fertig, Papa. Darf ich aufstehen?«
»Du bleibst sitzen«, sagte der Vater mit drohender Stimme.
Verschüchtert meinte Marcello: »Aber die Katze lebt doch …«
»Ich habe dir gesagt – bleib sitzen!« befahl der Vater nochmals. Dann, als seien Marcellos Worte für ihn das Signal gewesen, das lange Schweigen zu durchbrechen, wandte er sich an seine Frau: »Also – sag etwas! Sprich!«
»Ich habe nichts zu sagen«, erwiderte sie mit betonter Würde, die Augen niedergeschlagen, einen verächtlichen Zug um den Mund. Sie trug ein schwarzes, ausgeschnittenes Abendkleid. Marcello bemerkte, daß sie zwischen den mageren Fingern ein kleines Taschentüchlein hielt und oftmals an die Nase führte. Mit der anderen Hand griff sie dann und wann nach einem auf dem Tisch liegenden Stück Brot, und zwar mit den Fingerspitzen und den Nägeln, wie ein Vogel, der Krumen aufpickt.
»Sag schon, was du zu sagen hast! Sprich! Zum Donnerwetter!«
»Dir habe ich nichts zu sagen …«
Marcello begriff erst jetzt, daß nicht sein Katzenmord den Ärger der Eltern verursacht hatte. Dann, plötzlich überstürzte sich alles. Der Vater sagte nochmals: »Sprich! Zum Donnerwetter!« Als einzige Antwort zuckte die Mutter mit den Schultern. Da ergriff der Vater das vor ihm stehende Kelchglas und schrie: »Willst du sprechen? Ja oder nein?« Er schmetterte das Glas auf den Tisch, es zerbrach und der Vater führte mit einem Fluch die verletzte Hand zum Mund. Erschrocken erhob sich die Mutter und eilte zur Tür. Beinahe wollüstig sog der Vater das Blut aus seiner Wunde, die Brauen hatte er zu einem dichten Bogen zusammengezogen. Als er sah, daß seine Frau davonlief, unterbrach er sich in seiner Beschäftigung und schrie: »Ich verbiete dir, zu gehen! Verstanden?« Darauf warf die Mutter heftig die Tür ins Schloß. Der Vater sprang auf und lief nun ebenfalls zur Tür. Erregt durch die Heftigkeit der Szene, rannte Marcello hinterher.
Der Vater befand sich auf der Treppe, hatte eine Hand auf dem Geländer, schien sich aber merkwürdigerweise gar nicht zu beeilen, obwohl er immer zwei Stufen auf einmal nahm. Es schien, als schwebe er schweigend zum Erdgeschoß hinab. Marcello mußte an den gestiefelten Kater denken. Er zweifelte gar nicht daran, daß der Vater auf seine Art schneller sein würde als die Mutter, die mit ihren kleinen, unordentlichen Schritten vor ihm die Treppe hinunterlief und dabei von ihrem engen Rock behindert wurde.
Jetzt bringt er sie um! dachte Marcello, der dem Vater folgte.
Im Erdgeschoß angelangt, eilte die Mutter zu ihrem Zimmer. Es gelang ihrem Mann, sich hinter ihr durch den Türspalt zu zwängen. Das alles sah Marcello, während er mit seinen kurzen Knabenbeinen die Treppe hinunterlief, der weder wie sein Vater zwei Stufen auf einmal nahm, noch wie seine Mutter hüpfen konnte. Schließlich unten angelangt, stellte er fest, daß plötzlich auf den Lärm der Verfolgung eine seltsame Stille eingetreten war. Die Tür zum Zimmer seiner Mutter war angelehnt geblieben. Marcello trat zögernd auf die Schwelle.
Zunächst sah er in dem halbdunklen Zimmer nur die beiden großen duftigen Vorhänge an den Fenstern, rechts und links von den Betten. Ein Luftzug wehte sie gerade in die Höhe, sie berührten fast den Deckenlüster. Diese weißen, schweigenden Vorhänge gaben dem halbdunklen Zimmer einen Anstrich von Verlassenheit – als wären die Eltern auf ihrer Verfolgung durch die geöffneten Fenster in die Sommernacht hinausgeflogen. Dann entdeckte Marcello in dem aus dem Korridor hereindringenden Lichtstreifen endlich seine Eltern, das heißt, er sah nur den Rücken des Vaters, unter dem die Mutter fast völlig verschwand. Ihre Haare lagen auf dem Kissen, mit einem Arm tastete sie nach dem Kopfende des Bettes. Krampfhaft suchte sich dieser Arm irgendwo festzuklammern, ohne daß ihm dies gelang. Der Vater, der die Mutter unter sich zu erdrücken schien, vollführte mit Schultern und Händen Bewegungen, als wolle er sie erdrosseln.
Er bringt sie um! dachte Marcello. Er stand immer noch auf der Schwelle und empfand eine seltsame kämpferische und grausame Erregung und den Wunsch, in diesen Kampf einzugreifen. Ob er dem Vater helfen oder die Mutter verteidigen wollte, das wußte er eigentlich nicht. Auf einmal hoffte er, daß durch dieses sich hier anbahnende, viel schlimmere Verbrechen sein eigenes ausgelöscht werde. Was bedeutete schon die Tötung einer Katze, gemessen an der Tötung einer Frau?
Als Marcello gerade sein letztes Zögern überwunden hatte und sich fasziniert und voller Kampfeslust ins Zimmer hineinbewegte, ertönte die Stimme seiner Mutter – nicht wie die eines Menschen, der erdrosselt wird, sondern fast zärtlich. Sie murmelte: »Laß mich …« Doch ihr erhobener Arm, der bis jetzt immer noch das Kopfende des Bettes gesucht hatte, senkte sich und umschlang den Nacken des Mannes. Verwundert und beinahe enttäuscht tat Marcello ein paar Schritte zurück und trat auf den Korridor hinaus.
Читать дальше