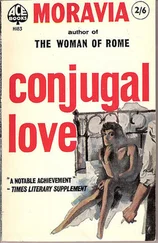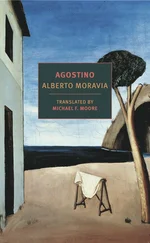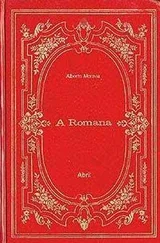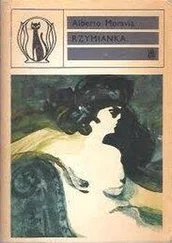Er sah, wie sie sich beinahe ärgerlich auf der Schwelle umwandte. »Was ist denn, Marcello?« fragte sie und ging wieder auf das Bett zu. Jetzt stand sie nahe bei ihm, im Gegenlicht, weiß und zart in ihrem ausgeschnittenen schwarzen Kleid. Das feine, bleiche, von schwarzen Haaren umrahmte Gesicht lag zwar im Schatten, aber Marcello konnte doch Eile, Ungeduld und Unzufriedenheit auf ihren Zügen erkennen. Trotzdem ließ er sich von einem Impuls hinreißen und erklärte: »Mama, ich muß dir etwas sagen …«
»Ja, Marcello, aber mach es rasch. Ich muß gehen. Papa wartet schon.« Dabei nestelte sie mit beiden Händen an dem Verschluß ihrer Halskette.
Marcello wollte nun der Mutter von dem Eidechsenmord erzählen und sie fragen, ob er etwas Schlimmes getan habe. Doch die Eile der Mutter veranlaßte ihn, seinen Plan zu ändern, oder vielmehr den Satz abzuändern, den er in Gedanken bereits vorbereitet hatte. Eidechsen erschienen ihm plötzlich als zu kleine und unbedeutende Tiere, um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu fesseln, der in Eile war. Er erfand also eine Lüge, die seine Missetat vergrößerte. Mit dem Eingeständnis einer enormen Schuld hoffte er, das Gefühl der Mutter erwecken zu können, dessen dumpfe Trägheit er nur ahnte. Mit einer Sicherheit, über die er sich selbst wunderte, sagte er: »Mama, ich habe eine Katze umgebracht!«
Soeben war es der Mutter fast gelungen, die beiden Teile des Halskettenverschlusses zusammenzubringen. Die Hände hinter dem Nacken verschränkt, das Kinn auf die Brust gepreßt, blickte sie zur Erde und klopfte ungeduldig mit dem Schuhabsatz auf den Boden. »Ach so?« fragte sie mit verständnisloser Stimme. Es schien, als hätten ihre Bemühungen um die Halskette ihre Aufmerksamkeit restlos in Anspruch genommen.
Unsicher geworden, setzte Marcello hinzu: »Ich hab sie mit der Schleuder umgebracht …« Die Mutter schüttelte verärgert den Kopf. Sie nahm die Hände vom Nacken, zwischen den Fingern die Halskette, die zu schließen ihr noch immer nicht gelungen war. »Dieser verdammte Verschluß!« rief sie wütend. »Marcello, sei lieb! Hilf mir!« Sie setzte sich schräg aufs Bett, wandte dem Sohn den Rücken zu und fuhr ungeduldig fort: »Gib aber acht, daß der Verschluß wirklich zuschnappt! Sonst springt er gleich wieder auf.«
Während sie sprach, hatte Marcello die mageren, bis zum Kreuz entblößten Schulterblätter vor sich. In dem Lichtschein, der von der Tür ins Zimmer fiel, waren sie weiß wie Papier. Die schlanken Hände mit den spitzen, scharlachroten Fingernägeln hielten das Schmuckstück auf dem zarten, mit einem Schatten dunklen Flaums bedeckten Nacken.
Marcello dachte: Wenn das Kollier geschlossen ist, hört sie mich mit mehr Geduld an. Er beugte sich also vor, ergriff die beiden Teile des Schlosses und brachte sie mit einem Griff zum Einschnappen. Aber jetzt erhob sich die Mutter sofort, neigte sich mit einem flüchtigen Kuß über ihn und sagte: »Danke. Nun schlaf. Gute Nacht!« Und ehe Marcello sie zurückzuhalten vermochte, verschwand sie.
Am folgenden Tag war das Wetter warm, der Himmel bewölkt. Marcello aß schweigend zwischen den beiden schweigenden Eltern, glitt dann von seinem Stuhl und ging in den Garten hinaus. Wie gewöhnlich bewirkte der volle Magen in ihm ein träges Unbehagen, vermischt mit nachdenklicher Sinnlichkeit. Er schritt leise, beinahe auf den Zehenspitzen, über den knirschenden Kies im Schatten der von Insekten umschwirrten Bäume, erreichte das Gartengitter und blickte hinaus. Vor sich hatte er das wohlbekannte Bild der sanft abfallenden Straße mit ihrer Doppelreihe milchiggrüner Pfefferbäume. Sie war zu dieser Stunde menschenleer und unter den tiefen, schwarzen Wolken am Himmel seltsam dunkel. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren andere Gitter, andere Gärten, andere Villen, aber alle ähnelten dem Besitz seiner Eltern. Nachdem er die Straße aufmerksam betrachtet hatte, trat Marcello vom Gitter zurück, zog seine Schleuder hervor und bückte sich. Zwischen dem feinen Kies lagen etliche größere weiße Steinchen. Eines dieser Steinchen, in der Form einer Nuß, ergriff Marcello und schob es in die Lederschlaufe der Schleuder. Dann begann er längs der Mauer, die seinen Garten von dem Robertos trennte, auf und ab zu gehen.
Er hatte den Eindruck, daß er sich jetzt im Kriegszustand mit Roberto befand. Er mußte also mit größter Aufmerksamkeit den Efeu an der Trennungsmauer überwachen und bei der geringsten Bewegung im Blätterwerk schießen. In diesem Spiel äußerte sich sein Zorn gegen Roberto, der nicht Komplice bei dem Eidechsenmord hatte sein wollen. Genauso hatte sich Marcellos grausamer Instinkt in dem gestrigen Gemetzel geäußert.
Natürlich wußte Marcello sehr wohl, daß Roberto keineswegs durch den Efeu zu ihm herüberspähte, denn er pflegte um diese Zeit zu schlafen. Trotzdem benahm sich Marcello so, als befände sich der andere in der Nähe. Der alte, gewaltige Efeustock wuchs bis zu den Spitzen des Gitters empor, und seine großen, schwärzlichen, staubigen Blätter lagen dicht übereinander, gleich Spitzenvolants auf einer ruhigen Frauenbrust. Kein Windhauch bewegte sie. Ein paarmal glaubte Marcello, ein Beben im Blätterwerk zu bemerken, das heißt, er redete sich ein, ein solches Beben wahrzunehmen. Da schleuderte er schließlich gezielt seinen Stein ins Gebüsch.
Gleich darauf beugte er sich hastig nieder, suchte einen zweiten Stein und setzte sich wieder in Kampfstellung: die Beine gespreizt, die Arme vorgestreckt, die Schleuder abschußbereit. Konnte es nicht sein, daß Roberto doch hinter den Blättern stand und auf ihn zielte? Aber Roberto ist im Vorteil, dachte Marcello, er ist unsichtbar, während ich ohne jede Deckung bin.
Im Laufe dieses Spiels gelangte er bis ans Ende des Gartens, dorthin, wo er in das Grün des Efeus eine Art Fenster geschnitten hatte. Er blieb stehen und betrachtete aufmerksam die Umfassungsmauer. In seiner Phantasie war das Haus ein Schloß, dessen Mauern von den Kletterpflanzen vollkommen verborgen waren. Nur das Loch im Efeu stellte eine gefährliche, leicht zu überwindende Bresche dar. Plötzlich sah Marcello die Blätter erzittern. Etwas bewegte sich von rechts nach links. Also mußte irgendwer dort sein. Im selben Augenblick dachte er: Roberto kann nicht dort sein, das Ganze ist ein Spiel, also darf ich den Stein ruhig schleudern … Und gleichzeitig dachte er: Roberto ist doch dort, ich darf den Stein nicht schleudern, um ihn nicht zu treffen. Dann, mit plötzlichem, unüberlegtem Entschluß, spannte er die Gummibänder und schoß den Stein in das dichteste Blätterwerk ab. Nicht genug damit, beugte er sich sofort wieder nieder, nahm hastig einen anderen Stein, tat ihn in die Schleuder und schoß zum zweiten Mal. Kurz darauf schoß er zum dritten Mal. Mittlerweile hatte er alle Bedenken und Ängste beiseite geschoben. Es war ihm gleichgültig, ob Roberto dort stand oder nicht. Das einzige, was er empfand, war ein Gefühl kämpferischer Heiterkeit. Er hatte tüchtig in die Blätterwand hineingeschossen, ließ nun die Schleuder keuchend zu Boden fallen und schlich sich an die Mauer heran. Es war, wie er es nicht nur erhofft, sondern sogar gewußt hatte: von Roberto war nichts zu sehen.
Die Gitterstäbe waren sehr weit und gestatteten ihm, seinen Kopf in den fremden Garten zu stecken. Von irgendeiner ganz unklaren Neugier befallen, schaute er zu Boden. An dieser Stelle in Robertos Garten gab es keine Schlinggewächse, sondern eine Irishecke, die zwischen der Mauer und dem Kiesweg verlief. Gerade unter Marcellos Augen, zwischen der Mauer und den weißen und violetten Irisblüten, sah er eine große graue Katze auf der Seite liegen. Er bemerkte die unnatürliche Lage des Tieres – die Pfoten von sich gestreckt, die Schnauze an der Erde – und ein sinnloser Schrecken raubte ihm den Atem. Das dichte bläulich-graue Fell wirkte struppig, ein wenig gesträubt und dabei unbewegt – wie bei jenen toten Tieren, die Marcello vor einer Weile auf dem Marmortisch in der Küche gesehen hatte. Sein Entsetzen steigerte sich immer mehr. Er sprang von seinem Beobachtungsposten hinab, zog aus einem Rosenstrauch eine Stange, kletterte wieder empor, schob den Arm zwischen die Gitterstäbe und stach mit dem erdigen Ende seiner Stange nach der Katze. Doch diese rührte sich nicht. Mit einemmal schienen ihm die Irisblüten auf ihrem hohen grünen Stengel mit den roten und violetten Kronen, rings um den grauen, regungslosen Körper, Totenblumen zu sein, die eine mitleidige Hand für den Leichnam gebracht hatten. Er warf die Stange fort und sprang zur Erde, ohne den Efeu wieder in Ordnung zu bringen.
Читать дальше