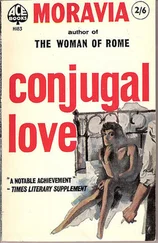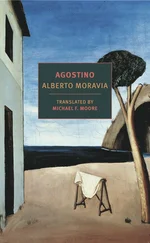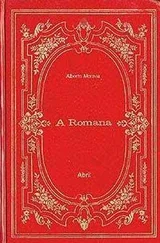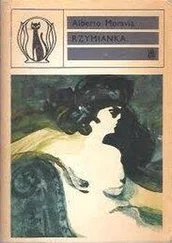Langsam und vorsichtig, um keinen Lärm zu machen, wandte er sich dem Untergeschoß und der Küche zu. Schon quälte ihn wieder die Neugier: War die Katze, die vom Fenster gesprungen war, mit der identisch, die er im Garten hatte liegen sehen? Als er die Küchentür aufstieß, bot sich ihm ein Bild häuslichen Friedens: In der weißen Küche saßen zwischen dem elektrischen Herd und dem Eisschrank die ältliche Köchin und das junge Stubenmädchen beim Essen an ihrem Marmortisch. Und auf dem Fußboden, unter dem Fenster, hockte die Katze und leckte mit rosafarbener Zunge Milch aus einer Schüssel. Doch es war, wie Marcello sofort enttäuscht feststellte, keineswegs die bewußte graue Katze, sondern ein ganz anderes, gestreiftes Tier.
Da er nicht wußte, wie er sein Auftauchen in der Küche rechtfertigen sollte, ging er zu der Katze, beugte sich hinab und streichelte ihren Rücken. Das ließ sie sich, ohne ihre Mahlzeit zu unterbrechen, schnurrend gefallen. Die Köchin erhob sich und schloß die Tür. Dann öffnete sie den Eisschrank, nahm einen Teller mit einem Tortenstück heraus, stellte ihn auf den Tisch, schob einen Stuhl heran und sagte zu Marcello: »Willst du ein Stück Torte? Von gestern abend? Ich hab es eigens für dich aufgehoben.« Marcello gab keine Antwort, ließ die Katze, setzte sich und begann zu essen.
Das Stubenmädchen sagte: »Gewisse Dinge verstehe ich einfach nicht. Da haben sie den ganzen Tag Zeit und soviel Platz im Haus – warum müssen sie gerade bei Tisch in Gegenwart des Jungen streiten?«
Die Köchin erwiderte belehrend: »Wenn man sich um seine Kinder nicht kümmern will, soll man sie nicht in die Welt setzen.«
Nach einem kurzen Schweigen bemerkte das Stubenmädchen: »Er könnte seinem Alter nach ihr Vater sein … Natürlich kann das nicht gut gehen.«
»Wenn’s sich nur darum drehte …« meinte die Köchin und warf einen bedeutsamen Blick auf Marcello.
»Außerdem«, fuhr das Stubenmädchen fort, »ist dieser Mann meiner Meinung nach nicht normal.«
Marcello aß zwar weiter, spitzte aber bei dieser Bemerkung die Ohren. »Auch sie ist der gleichen Ansicht«, schwatzte das Mädchen. »Wissen Sie, was sie mir vor kurzem gesagt hat, als ich sie am Abend auskleidete? ›Giacomina‹, hat sie gesagt, ›früher oder später wird mich mein Mann umbringen.‹ Da hab ich gefragt, warum gehen Sie denn dann nicht von ihm fort? Und sie …«
»Psssttt …« unterbrach die Köchin und deutete auf Marcello. Das Stubenmädchen verstand und fragte den Jungen: »Wo sind denn Papa und Mama?«
»Oben im Zimmer«, erwiderte Marcello. Und dann, wie von einem unwiderstehlichen Impuls getrieben, fügte er hinzu: »Papa ist wirklich nicht normal. Wißt ihr, was er getan hat?«
»Nein, was denn?«
»Er hat eine Katze getötet.«
»Eine Katze? Wie denn?«
»Mit meiner Schleuder. Ich hab gesehen, wie er im Garten eine graue Katze verfolgte, die auf der Mauer entlangging. Dann nahm er einen Stein, schoß ihn nach der Katze und traf sie. Die Katze fiel hinunter in den Garten Robertos. Ich habe später nachgeschaut und festgestellt, daß sie wirklich tot war.« Während des Sprechens ereiferte sich Marcello, behielt aber den Ton eines unschuldigen Jungen bei, der ahnungslos und naiv von einer Missetat erzählt, deren Zeuge er gewesen ist.
»Nein so was!« rief das Stubenmädchen und schlug die Hände zusammen. »Eine Katze! Ein Mann dieses Alters, ein Herr, nimmt die Schleuder seines Sohnes und bringt damit eine Katze um! Wenn das nicht verrückt ist!«
»Wer schlecht zu den Tieren ist, der ist auch schlecht zu den Menschen«, sagte die Köchin. »Erst erschlägt man eine Katze und zuletzt einen Menschen.«
»Warum?« fragte Marcello und hob plötzlich die Augen von seinem Teller.
»So sagt man«, erwiderte die Köchin und streichelte ihn. »Obwohl es nicht immer wahr ist …« fuhr sie zu dem Stubenmädchen gewandt fort. »Der Mörder aus Pistoja, der die vielen Leute umgebracht hat … Das hab ich in der Zeitung gelesen, wissen Sie … Haben Sie eine Ahnung, was er jetzt im Gefängnis tut? Er hält sich einen Kanarienvogel!«
Die Torte war zu Ende. Marcello stand auf und verließ die Küche.
Die Köchin hatte gesagt: »Erst erschlägt man eine Katze und zuletzt einen Menschen …« Der Schrecken vor dieser Schicksalhaftigkeit verblaßte bei Marcello während der Sommerferien am Meer, und die ganze Angelegenheit wurde beinahe bedeutungslos. Er dachte zwar noch an den undurchschaubaren grausamen Mechanismus, in dem sein Leben für ein paar Tage gefangen gewesen war, sagte sich aber: Es hat sich nur um ein Alarmsignal gehandelt, jedoch nicht um eine unannehmbare Verurteilung, wie ich das eine Weile befürchtete.
Die Tage verstrichen in Heiterkeit, Sonne und im Rausch der salzigen Meerluft. Es gab Zerstreuungen und Entdeckungen. Marcello kam sich mit jedem Tag mehr als ein Sieger vor: im Kampf gegen ein dunkles, bösartiges, tragisches Verhängnis, das ihn gegen seinen Willen erst zu der Zerstörung der Blumen, dann zum Eidechsengemetzel und schließlich bis zum Mordversuch an Roberto getrieben hatte. Allerdings spürte er, daß jene Macht immer noch gegenwärtig war und immer noch drohte, nur hatte sie ihn nicht mehr direkt in ihren Krallen. Er benahm sich wie in Angstträumen: Man versucht, einem Ungetüm zu entgehen, indem man sich schlafend stellt. Wenn man schon eine drohende Gefahr nicht beseitigen kann, überlegte er, ist es weise, sich wie im Traum zu verhalten.
Der Sommer wurde einer der ausgelassensten, wenn nicht sogar glücklichsten in seinem Leben überhaupt. Es war der letzte Sommer, in dem er noch ein Kind war – ohne einen Widerwillen gegen seine Kindlichkeit zu verspüren.
Zum Teil hing seine Gelöstheit einfach mit seinem Knabenalter zusammen, zum Teil rührte sie aber auch von dem Willen her, um jeden Preis aus der verdammten schicksalhaften Vorausbestimmung zu entfliehen. Er fragte sich nicht, was ihn dazu trieb, zehnmal an einem Vormittag ins Wasser zu springen, mit den wildesten Spielkameraden zu wetteifern, stundenlang auf dem sonnenüberglühten Meer zu rudern, kurzum, alles, was er tat, mit übersteigertem Eifer zu tun. Es war derselbe Impuls, der ihn veranlaßt hatte, die Spießgesellenschaft Robertos nach dem Eidechsenmord zu suchen, die Bestrafung durch die Eltern nach der Tötung der Katze herbeizusehnen: das Bedürfnis nach Normalität und der Wunsch, sich einer allgemein anerkannten Regel anzupassen, also allen anderen gleich zu sein. Denn Anderssein bedeutete ja soviel wie Schuldigsein. Mitunter freilich verriet sich das Gewollte und Künstliche seines Verhaltens in einer plötzlich aufzuckenden schmerzlichen Erinnerung. Er sah wieder die tote Katze zwischen den weiß-violetten Irisblüten in Robertos Garten liegen. Und er erschrak wie ein Schuldner, der im Geist aufs neue seine Unterschrift auf seinem Schuldschein erblickt. Hatte er vielleicht doch mit jener Katzenleiche eine dunkle, fürchterliche Verpflichtung auf sich genommen, der er sich früher oder später nicht würde entziehen können? Auch dann nicht, wenn er sich tief in der Erde verstecken oder über den Ozean entfliehen würde, um seine Spuren zu verwischen?
In solchen Augenblicken tröstete er sich mit dem Gedanken, daß ja zwei, drei Monate schon vergangen waren. Bald würden Jahre vorüber sein. Es kam vor allem darauf an, viel Zeit verstreichen zu lassen, ohne das Ungeheuer zu reizen. Solche Anfälle von Gewissensnöten wurden aber immer seltener und hörten gegen Ende des Sommers völlig auf. Als Marcello schließlich nach Rom zurückkehrte, hatte sich die Katzenepisode und alles, was vorher geschehen war, in seiner Erinnerung fast verflüchtigt. Sie war verblichen, beinahe durchscheinend geworden wie eine in einem anderen Leben gemachte Erfahrung. Sie reichte nur noch als ein folgenloses Ereignis in seine jetzige Existenz hinein, an das ihn keine Verantwortung mehr band.
Читать дальше