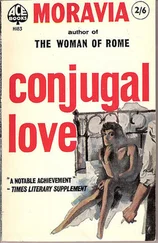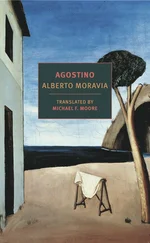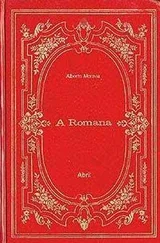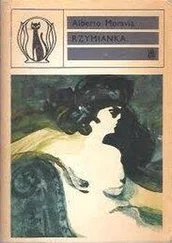»Und die Pistole?«
Lino seufzte und zog widerwillig die Waffe aus der Tasche. Marcello streckte die Hand danach aus. Linos Gesicht verhärtete sich plötzlich, er zog die Pistole zurück und sagte hastig:
»Ich geb sie dir … Aber erst mußt du sie dir verdienen …«
Bei diesen Worten empfand Marcello beinahe etwas wie Erleichterung: Es war also doch so, wie er gedacht hatte, Lino wollte im Tausch gegen die Pistole etwas haben. In falsch-unschuldigem Ton, als ginge es darum, unter Schulkameraden Federn gegen Glaskugeln einzutauschen, meinte er: »Sag du, was du dafür willst. Und dann werden wir uns einigen.«
Lino schlug den Blick nieder und zögerte, ehe er langsam fragte: »Was würdest du tun, um diese Pistole zu bekommen?«
Marcello bemerkte, daß Lino seiner Frage ausgewichen war. Offenbar handelte es sich also nicht um einen Gegenstand, der gegen die Pistole einzutauschen war, sondern darum, irgend etwas zu tun. Er hatte keine Ahnung, was Lino vom ihm verlangen könne. Immer noch in demselben gemacht harmlosen Ton sagte er: »Ich weiß nicht … Sag du mir’s …«
Ein Augenblick des Schweigens folgte. »Würdest du alles tun? Was auch immer?« fragte plötzlich Lino laut und packte ihn bei der Hand.
Der Ton und die Geste alarmierten Marcello. Er überlegte sekundenlang, ob Lino nicht etwa ein Einbrecher sei, der ihn zum Spießgesellen machen wollte. Nach kurzer Überlegung glaubte er allerdings, diese Möglichkeit ausschließen zu können. Immerhin antwortete er vorsichtig: »Aber was willst du denn, daß ich tue? Warum sagst du’s nicht klipp und klar?«
Lino spielte jetzt mit Marcellos Hand, wandte sie hin und her, besah sie, drückte sie fest, ließ dann wieder locker. Auf einmal stieß er sie mit beinahe grober Geste weg und sagte langsam, indem er Marcello ansah: »Ich bin sicher, daß du gewisse Dinge nicht tätest.«
»So rede doch endlich schon!« beharrte Marcello betreten, aber nicht ganz ohne Bereitwilligkeit.
»Nein, nein!« rief Lino. Marcello bemerkte, daß auf den bleichen Backenknochen des Chauffeurs sonderbare, unregelmäßige rote Flecken erschienen waren. Offensichtlich wollte Lino zwar gern sprechen, jedoch nicht ohne vorher sicherzugehen, daß Marcello dann auch mit seinem Vorschlag einverstanden sein würde.
Da vollführte Marcello eine Geste, bewußter, wenngleich unschuldiger Koketterie, er beugte sich vor und ergriff die Hand Linos. »Sag doch, was du willst«, ließ er sich vernehmen. »Warum sagst du’s denn nicht?«
Ein langes Schweigen folgte. Lino sah abwechselnd Marcellos Hand und dessen Gesicht an, schien zu zögern. Schließlich stieß er die Hand des Jungen ein zweites Mal zurück, jedoch sanft, erhob sich und machte ein paar Schritte durchs Zimmer. Dann setzte er sich von neuem, ergriff wieder Marcellos Hand – zärtlich, wie ein Vater oder eine Mutter die Hand des Sohnes ergreift. »Marcello«, fragte er, »weißt du, wer ich bin?«
»Nein.«
»Ich bin ein aus der Kutte gesprungener Priester«, sagte Lino, und in seiner Stimme lag ein Ton tiefen Schmerzes. »Vielmehr ein Priester, der mit Schimpf und Schande als unwürdig aus dem Kolleg verjagt worden ist, an dem er lehrte … Und du, in deiner Unschuld, hast keine Ahnung, was ich von dir verlange im Tausch für diese Pistole, die du so gern haben möchtest. Ich bin in Versuchung, deine Unwissenheit, deine kindliche Habgier zu mißbrauchen … Jetzt weißt du, wer ich bin, Marcello.« Er hatte im Ton völliger Aufrichtigkeit gesprochen. Nun wandte er sich unerwartet dem Kopfende des Bettes zu und sprach zu dem Kruzifix, ohne die Stimme zu erheben, klagend: »Ich habe so zu dir gebetet …. Aber du hast mich verlassen! Und immer, immer falle ich von neuem! Warum hast du mich verlassen?« Linos weitere Worte verloren sich in einer Art Gemurmel, als spräche er zu sich selbst. Dann erhob er sich vom Bett und sagte zu Marcello: »Vorwärts …! Komm! Ich bringe dich heim!«
Marcello schwieg. Er war wie betäubt und einstweilen außerstande, über all dies nachzudenken. Er folgte Lino auf den Korridor und dann in das große Wohnzimmer. Draußen, auf dem Vorplatz, wehte noch immer der Wind unter dem bewölkten, sonnenlosen Himmel.
Lino bestieg das Auto, Marcello setzte sich neben ihn. Der Wagen fuhr an, glitt über die Zufahrt und durch das Tor auf die Straße hinaus. Eine ganze Weile wechselten die beiden kein Wort miteinander. Lino saß wie früher am Lenkrad: den Oberkörper steif aufgerichtet, das Mützenschild tief über den Augen, die behandschuhten Hände am Volant. Nach einer ganzen Weile fragte Lino schließlich, ohne sich umzuwenden:
»Tut es dir leid um die Pistole?«
Bei diesen Worten wachte in Marcello wieder die Hoffnung auf, diese so sehr begehrte Pistole doch zu erhalten. Schließlich und endlich, dachte er, ist vielleicht noch nicht alles verloren … Also antwortete er ehrlich: »Freilich tut es mir leid!«
»Demnach«, fragte Lino, »würdest du kommen, wenn ich mich für morgen mit dir verabredete – um die gleiche Stunde wie heute?«
»Morgen ist Sonntag«, erwiderte Marcello. »Aber übermorgen. Wir könnten uns wieder in der Allee treffen, an derselben Stelle …«
Der andere schwieg einen Augenblick. Dann rief er plötzlich laut und mit klagender Stimme: »Sprich nicht mehr mit mir! Schau mich nicht mehr an! Und wenn du mich Montag mittag in der Allee siehst – hör nicht auf mich! Grüß mich nicht einmal! Verstanden?«
Was hat er denn? fragte sich Marcello etwas ärgerlich. Und er antwortete: »Ich lege keinen Wert darauf, dich zu sehen. Du selbst hast mich heute zu dir gebracht!«
»Ja, aber das darf nicht wieder geschehen! Nie mehr!« erklärte Lino mit Entschiedenheit. »Ich kenne mich und weiß, daß ich nun die ganze kommende Nacht an dich denken werde und daß ich Montag in der Allee auf dich warten werde. Auch wenn ich heute beschließe, es nicht zu tun. Ich kenne mich. Aber du darfst dich nicht um mich kümmern.«
Marcello sagte nichts. Lino aber redete mit der gleichen Heftigkeit. »Ich werde die ganze Nacht an dich denken, Marcello. Montag werde ich in der Allee sein – mit der Pistole, aber du darfst mich nicht beachten.« Immer von neuem wiederholte er diesen Satz. Marcello begriff mit seiner kalten, unschuldigen Hellsichtigkeit, daß Lino zwar mit ihm eine Verabredung traf, ihn zugleich aber vor dieser Verabredung warnte.
Nach einem Augenblick des Schweigens fragte Lino von neuem: »Hast du gehört?«
»Ja.«
»Was hab ich gesagt?«
»Daß du mich Montag in der Allee erwarten wirst.«
»Ich hab dir nicht nur das gesagt …« meinte Lino.
»Und daß ich mich nicht um dich kümmern soll«, schloß Marcello.
»Ja«, bestätigte Lino, »auf gar keinen Fall! Ich werde dich rufen, dich anflehen, dir mit dem Wagen nachfahren … Ich werde dir alles versprechen, was du nur willst. Aber du mußt geradeaus weitergehen und darfst nicht auf mich hören.«
Marcello verlor die Geduld und sagte: »Schon gut! Ich hab’s verstanden.«
»Aber du bist ein Kind«, sagte Lino und wechselte von der bisherigen Heftigkeit zu plötzlicher Weichheit hinüber. »Und du wirst nicht imstande sein, mir zu widerstehen. Du wirst zweifellos mit mir kommen … Du bist ein Kind, Marcello.«
Marcello war beleidigt. »Ich bin kein Kind mehr! Ich bin ein Junge! Du kennst mich noch nicht.«
Lino hielt den Wagen plötzlich an. Sie befanden sich noch auf der Hügelstraße zu Füßen einer hohen Mauer, nicht weit entfernt von der mit Lampions geschmückten Einfahrt zu einem Restaurant. Lino wandte sich Marcello zu. »Wirklich?« fragte er mit einer Art schmerzlicher Sorge. »Würdest du dich wirklich weigern, mit mir zu kommen?«
»Du bist es doch«, erwiderte Marcello, der sich jetzt seines Spiels bewußt war, »der das von mir verlangt.«
Читать дальше