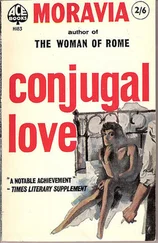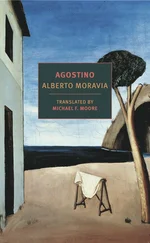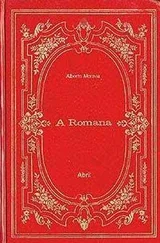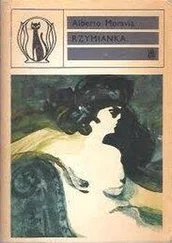»Ja.« Verzweifelt fuhr Lino fort: »Das ist wahr.« Er setzte den Wagen wieder in Bewegung. »Du hast recht, ich bin der Verrückte, der das von dir verlangt. Gerade ich!«
Nach diesem Ausruf verstummte er und verfiel in ein längeres Schweigen. Der Wagen fuhr noch ein Stück auf der Straße weiter und durchquerte dann wieder die schmutzige Vorstadt. Dann kamen sie zu der breiten Allee mit den kahlen Platanen, den Haufen abgefallener Blätter längs der verlassenen Gehsteige, den Villen mit ihren vielen Fenstern. Nun hatten sie das Viertel erreicht, in dem sich das Haus von Marcellos Eltern befand.
Ohne sich umzuwenden, fragte Lino: »Wo ist euer Haus?«
»Halt lieber hier an«, sagte Marcello und war sich bewußt, wie wohltuend dieser Verschwörerton auf Lino wirkte. »Man könnte sonst sehen, daß ich aus deinem Wagen steige.«
Das Auto hielt. Marcello stieg aus. Lino reichte ihm durch das Wagenfenster das Bücherpaket und sagte mit Entschiedenheit:
»Also auf Montag! In der Allee. An derselben Stelle wie heute.«
»Aber ich«, sagte Marcello und ergriff die Bücher, »muß so tun, als sähe ich dich nicht, wie?«
Lino zögerte mit der Antwort. Marcello empfand eine beinahe grausame Genugtuung. Linos tiefeingesunkene Augen hatten einen flehenden, gequälten Blick. Dann sagte er: »Tu, was du für gut hältst. Mach mit mir, was du willst.« Seine Stimme versagte in einer Art halbgesungener Klage.
»Ich werde dich überhaupt nicht ansehen!« verkündete Marcello zum letztenmal.
Lino vollführte eine unverständliche Handbewegung, die vielleicht verzweifelte Zustimmung ausdrücken sollte.
Dann fuhr das Auto an und entfernte sich langsam in der Richtung auf die Allee zu.
Jeden Morgen wurde Marcello zu einer bestimmten Zeit von der Köchin geweckt. Sie hatte ihn besonders ins Herz geschlossen. Sie betrat im Finstern das Zimmer, stellte das Tablett mit dem Frühstück auf die Marmorplatte der Kommode und hängte sich an die Gurte des Rolladens, um ihn mit zwei oder drei kräftigen Rucken hochzuziehen. Dann stellte sie das Tablett auf Marcellos Knie und wartete stehend, bis er sein Frühstück beendet hatte. Darauf zog sie ihm sofort die Decken weg und jagte ihn ins Badezimmer. Auch beim Anziehen half sie, indem sie ihm die einzelnen Stücke reichte, oft auch niederkniete, um ihm die Schuhe zuzuschnüren. Diese Köchin war eine lebhafte, fröhliche und durchaus vernünftige Person. Sie hatte den Tonfall und die Gewohnheiten der Provinz, in der sie geboren war.
Montag morgen erwachte Marcello mit der unbestimmten Erinnerung, am Abend vor dem Einschlafen zornige Stimmen gehört zu haben. Doch er hatte keine Ahnung, ob sie aus dem Erdgeschoß oder aus dem Schlafzimmer der Eltern gekommen waren. Er wartete, bis er mit dem Frühstück fertig war, und fragte dann ganz obenhin die Köchin, die wie gewöhnlich neben seinem Bett stand:
»Was ist denn gestern abend los gewesen?«
Sie sah ihn mit übertriebener, unechter Verwunderung an: »Nichts, wovon ich wüßte!«
Marcello begriff, daß sie sich zwar verstellte, ihm aber doch sehr gern etwas anvertrauen wollte: Die falsche Verwunderung, das maliziöse Funkeln ihrer Augen, ihre ganze Haltung verrieten es ihm.
Er sagte: »Ich habe Schreie gehört …«
»Ach das!« sagte die Frau. »Das ist doch das Übliche. Weißt du nicht, daß dein Papa und deine Mama oft schreien?«
»Ja«, gab Marcello zurück, »aber sie schrien lauter als sonst …«
Die Köchin lächelte, stützte sich mit beiden Händen auf das Fußende des Bettes und sagte: »So werden sie einander wenigstens besser verstanden haben, meinst du nicht?«
Dies war eine ihrer Besonderheiten: Fragen zu stellen, auf die sie keine Antwort erwartete.
Marcello erkundigte sich: »Aber warum haben sie geschrien?«
Die Köchin lächelte von neuem: »Warum schreien die Leute? Weil sie sich nicht vertragen.«
»Und warum vertragen sie sich nicht?«
»Die?« rief sie, glücklich über diese Frage des Knaben. »Ach … aus tausend Gründen. Einen Tag vielleicht, weil deine Mama bei offenem Fenster schlafen möchte und dein Papa nicht. Dann wieder, weil er früh zu Bett gehen möchte, sie aber nicht. An Gründen fehlt es da nie, wie?«
Marcello sagte plötzlich ernst und überzeugt, als handelte es sich um ein langgehegtes Gefühl: »Ich möchte nicht mehr länger hierbleiben.«
»Und was möchtest du statt dessen tun?« rief die Köchin, immer vergnügter. »Du bist klein und kannst nicht einfach von daheim fortgehen. Du mußt schon warten, bis du erwachsen bist.«
»Mir wär’s lieber«, sagte Marcello, »wenn sie mich in eine Anstalt schickten.«
Die Frau sah ihn gerührt an und rief: »Du hast recht! In einer Anstalt hättest du wenigstens jemanden, der sich um dich kümmerte. Willst du wissen, warum dein Papa und deine Mama heute nacht so gestritten haben?«
»Ja. Warum?«
»Warte, ich will dir was zeigen!« rief die Köchin. Sie eilte zur Tür und verschwand. Marcello hörte, wie sie Hals über Kopf die Treppe hinuntereilte, und fragte sich von neuem, was wohl am vergangenen Abend vorgefallen sein mochte. Gleich darauf hörte er die Köchin zurückkommen. Fröhlich und geheimnisvoll trat sie ein und hielt in der Hand einen Gegenstand, den Marcello wiedererkannte: eine große Fotografie im Silberrahmen, die für gewöhnlich im Salon auf dem Klavier stand. Die Aufnahme stammte aus einer Zeit, in der Marcello kaum mehr als zwei Jahre alt gewesen war. Man sah darauf Marcellos Mutter in einem weißen Kleid mit dem Kind im Arm, das ebenfalls ein weißes Kleidchen trug und eine weiße Schleife im Haar hatte.
»Siehst du, was mit diesem Bild geschehen ist?« fragte die Köchin. Dann fuhr sie fort: »Als deine Mama gestern abend aus dem Theater heimkam und den Salon betrat, war diese Fotografie das erste, was sie erblickte. Die Arme wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Siehst du, was dein Papa mit dieser Fotografie angestellt hat?«
Marcello betrachtete verblüfft das Bild: Irgendwer hatte mit der Spitze eines Federmessers oder mit einem Pfriem die Augen der Mutter und des Sohnes durchlöchert und beiden unter die Lider mit Rotstift hervorströmendes Blut gemalt. Die ganze Angelegenheit war so seltsam, unerwartet und zugleich dunkel-unheilvoll, daß Marcello zunächst gar nicht wußte, was er davon halten sollte.
»Ja, dein Papa hat das gemacht!« rief die Köchin. »Und deshalb hatte deine Mama allen Grund, zu schreien.«
»Aber warum hat er das gemacht?«
»Eine Hexerei! Eine fattura ! Weißt du, was das ist?«
»Nein.«
»Wenn man jemandem etwas Böses wünscht … Man kann auch statt der Augen die Brust durchlöchern in der Gegend des Herzens … Und dann geschieht etwas.«
»Was?«
»Die betreffende Person stirbt … Oder es stößt ihr ein Unglück zu, je nachdem …«
Marcello stammelte: »Aber ich habe Papa doch nichts Böses getan …!«
»Und deine Mama? Was hat die ihm getan?« rief die Köchin entrüstet. »Aber weißt du, was dein Papa ist? Verrückt ist er! Und weißt du, wo er enden wird? In Sant’ Onofrio, im Irrenhaus! Und jetzt los, zieh dich an! Es ist höchste Zeit, daß du in die Schule gehst. Ich stelle die Fotografie wieder an ihren Platz.« Quietschvergnügt eilte sie davon, und Marcello blieb allein.
In Gedanken versunken und unfähig, sich den Vorfall mit dem Bild irgendwie zu erklären, zog er sich an. Er hatte für seinen Vater nie besondere Gefühle gehegt. Dessen Feindseligkeit, ob echt oder vorgetäuscht, war ihm nie nahegegangen. Aber die Worte der Köchin über die böse Kraft einer Hexerei gaben ihm doch zu denken. Er war nicht abergläubisch und hielt es eigentlich nicht für möglich, daß man durch Beschädigung einer Fotografie der darauf abgebildeten Person wirklich ein Unglück zufügen könne. Trotzdem weckte die Wahnsinnstat bei ihm Ängste, von denen er geglaubt hatte, sie seien weitgehend gebannt: Er hatte wieder das beklemmende, ohnmächtige Gefühl, in ein tragisches Schicksal verstrickt zu sein. Fast den ganzen Sommer lang hatte ihn dieses Gefühl gequält, war dann aber allmählich verschwunden. Und jetzt, vor dieser mit blutigen Tränen besudelten Fotografie, hatte es sich wieder gemeldet.
Читать дальше