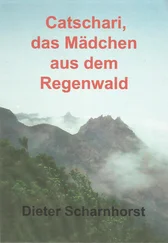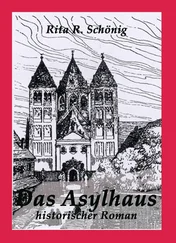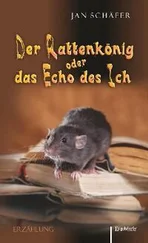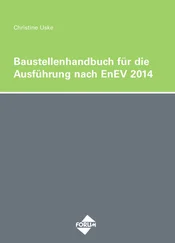Chemische Anforderung an das einzuleitende Bau- und Pumpwasser in den natürlichen Kreislauf
Chemische Anforderungen an das einzuleitende Pumpwasser in Form von Grenzwerten benennt das Wasserhaushaltsgesetz nicht. Nach § 48 Abs. (1) muss das einzuleitende Wasser so beschaffen sein, dass eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Für die Baumaßnahme müssen daher bei der jeweils zuständigen Behörde die Einleitgrenzwerte angefragt werden. Diese Grenzwerte richten sich z. B. nach der jeweiligen Gewässergüte des Vorfluters sowie der örtlichen Grundwassergüte. Oft werden die Geringfügigkeitsschwellen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) aus dem Jahre 2004 zur Bewertung verwendet.
Bei der Einleitung in einen Vorfluter wird in der gängigen Praxis die Herstellung eines Feststoffabsetzbeckens gefordert. Für die Bemessung des Absetzbeckens wird i. A. eine Verweilzeit von rund 15 bis 30 Minuten gefordert.
Chemische Anforderung an das einzuleitende Bau- und Pumpwasser in das öffentliche Kanalnetz
Die chemischen Anforderungen an das einzuleitende Pumpwasser in den öffentlichen Kanal sind bei dem jeweiligen kommunalen Kanalnetzbetreiber anzufragen. Hierbei werden in der gängigen Praxis die Parameter pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen, Mangan, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink, TOC, DOC und absetzbare Stoffe nach einer halben Stunde Ansetzzeit gefordert. Des Weiteren kann die Einhaltung bestimmter Tagesfrachten, z. B. für Eisen und Mangan, gefordert werden.
Erlaubt die Qualität des Pumpwassers keine Einleitung in den natürlichen Kreislauf (z. B durch Versickerung) oder in das öffentliche Kanalnetz, sind weitere Reinigungsmaßnahmen (z. B Stripanlagen) notwendig. Dies kann u. U. erhebliche Mehrkosten verursachen, insbesondere, wenn dies nicht rechtzeitig erkannt wurde.
 3.3.2 Angriffsgrad von Grundwasser
3.3.2 Angriffsgrad von Grundwasser
{Angriffsgrad}
Die Beton- und Stahlaggressivität von Grundwasser, aber auch in geringerem Maße des Bodens selber, ist für die dauerhafte Auslegung von Bauteilen, die mit aggressiven Wässern oder Böden in Berührung kommen, zu beachten. Neben allen Betonbauteilen (z. B. Gründungselemente, Pfähle, aufgehende Konstruktionen, Kellerwände, im Baugrund eingebettet Bauwerke, Tunnel, Betonrohre) sind aggressive Inhaltstoffe auch für Stahlbauteile für dauerhafte Zwecke (z. B. Spundwände im Kanal-/Hafen- oder Deichbau, Pfähle, Rohrleitungen, Rückverankerungen) zu beachten. Bei Bauteilen, bei denen Beton oder Zementstein einen Schutz für eingebauten Stahl bildet (z. B. bewehrte Betonbauteile, Verpressanker, Nägel), ist sowohl die Beton- als auch die Stahlaggressivität {Stahlaggressivität} zu berücksichtigen.
Betonaggressives Grundwasser {Grundwasser, betonaggressives}
In Böden mit Grundwassereinfluss können im Grundwasser gelöste Stoffe den Korrosionsprozess von Beton beschleunigen. Dabei wird in Stoffe unterschieden, die den Zementstein auflösen (z. B. kalklösende Kohlensäure, und Säuren allgemein) und damit für eine Auflösung der Oberfläche des Betons sorgen und in Stoffe, die ein Treiben verursachen und damit zum Aufreißen der Oberfläche und zu Abplatzungen an der Betonoberfläche führen (z. B. Sulfatangriff).
Um die Auswirkung von vorhandenem Wasser auf die Dauerhaftigkeit von Beton {Beton, Dauerhaftigkeit} beurteilen zu können, sind die betonangreifenden Stoffe im Grundwasser zu analysieren. Dazu zählen insbesondere:
| • |
pH-Wert |
| • |
kalklösende Kohlensäure |
| • |
Ammonium (NH4) |
| • |
Magnesium |
| • |
Sulfat |
Die Untersuchung von Wasser auf betonangreifende Inhaltsstoffe ist in der DIN 4030 geregelt. Dort sind auch Grenzwerte festgelegt, um die festgestellten Konzentrationen in Expositionsklassen einzuteilen. Es ist eine Unterteilung in die Klassen XA1 (schwach angreifend), XA2 (mäßig angreifend) und XA3 (stark angreifend) vorgesehen.
Maßgebend für die Beurteilung ist der jeweils höchste Angriffsgrad {Angriffsgrad} nach der Tabelle 4 der DIN 4030-1, auch wenn er nur von einem Wert der Zeilen 1 bis 5 erreicht wird. Liegen zwei oder mehrere Werte im oberen Viertel eines Bereiches (beim pH-Wert im unteren Viertel), so erhöht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (gilt nicht für Meerwasser), da erfahrungsgemäß dichter Beton dem Meerwasser trotz seiner sehr hohen Mg- oder SO4-Gehalte widersteht.
| Chemisches Merkmal |
XA1 |
XA2 |
XA3 |
| Grundwasser |
| SO42- mg/l |
> 600 und ≤ 3000 |
> 600 und ≤ 3000 |
> 3000 und ≤ 6000 |
| pH-Wert |
≤ 6,5 und ≥ 5,5 |
< 5,5 und ≥ 4,5 |
< 4,5 und ≥ 4,0 |
| CO2 mg/l angreifend |
≥ 15 und ≤ 40 |
> 40 und ≤ 100 |
> 100 bis zur Sättigung |
| NH4+ mg/l |
≥ 15 und ≤ 30 |
> 30 und ≤ 60 |
> 60 und ≤ 100 |
| MG2+ mg/l |
> 1000 und ≤ 3000 |
> 1000 und ≤ 3000 |
> 3000 bis zur Sättigung |
| Boden |
| SO42- mg/kga insgesamt |
≥ 2000 und ≤ 3000b |
> 3000b und ≤ 12000 |
> 12000 und ≤ 24000 |
| Säuregrad |
> 200 Baumann-Gully |
in der Praxis nicht anzutreffen |
| aTonböden mit einer Durchlässigkeit von weniger als 10-5 m/s dürfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.bFalls die Gefahr der Aufhäufung von Sulfationen im Beton, zurückzuführen auf wechselndes Trocknen und Durchfeuchten oder kapillares Saugen, besteht, ist der Grenzwert von 3000 mg/kg auf 2000 mg/kg zu vermindern. |
Tab. 10: Grenzwerte für die Expositionsklassen bei chemischem Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser (Quelle: DIN 4030)
Bei Böden ohne Grundwassereinfluss bestimmt die Aggressivität der Böden in Abhängigkeit des Bodenchemismus, der Wasserleit- und Speicherfähigkeit sowie der Menge und zeitlichen Verteilung des Niederschlags den Korrosionsprozess. Mit abnehmender Durchlässigkeit und Durchfeuchtung des Bodens nimmt auch der Aggressionsgrad ab, da angreifende Stoffe in anstehenden Böden und Gasen ihre Wirkung nur entfalten können, wenn ausreichend Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Für Bauwerke, die innerhalb dieser Bodenbereiche gründen, wird der Nachweise für Beton- und Metallagressivität im Boden maßgebend.
Der Untersuchungsumfang nach DIN 4030 umfasst jedoch nur die üblicherweise, natürlich vorkommenden Substanzen. Darüber hinaus können auch Stoffe aus der Industrie betonaggressiv wirken (z. B. jede Art von Säuren und viele Salze); auch Tausalz wirkt betonangreifend. Liegt ein Verdacht auf entsprechende Verunreinigungen im Grundwasser vor, sind besondere Untersuchungen auf diese Inhaltsstoffe und die Auswirkungen auf Beton erforderlich.
Um Beton vor betonangreifenden Inhaltsstoffen zu schützen, werden bei der Herstellung des Betons besonders kalkarme Zemente (Eisenportlandzement, Hochofenzement, Trasszement) oder spezielle sulfatbeständige Zemente verwendet. Weiterhin wird die Dichtigkeit des Betons erhöht bzw. der Porenraum verkleinert, um den Widerstand gegen chemische Angriffe zu verbessern.
Stahlaggressives Grundwasser {Grundwasser, stahlaggressives}
Die Stahlaggressivität {Stahlaggressivität} von Wässern wird nach DIN 50929 untersucht. Stahlaggressive Inhaltsstoffe beschleunigen den Korrosionsprozess. Zu den natürlich vorkommenden stahlaggressiven Inhaltsstoffen zählen:
| • |
Chlorid |
| • |
Sulfat |
| • |
Calcium |
| • |
Säurekapazität |
Außerdem ist die Beanspruchung des Bauteils mit Wasser wesentlich für die Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929. Dazu zählen insbesondere die Lage des Bauteils zur Wasser-/Luftgrenze und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Sauerstoff zur Oxidation vorliegt, sowie die Fließgeschwindigkeit des Wassers und damit die Möglichkeit eines ständigen Nachschubs aggressiver Inhaltsstoffe. Je nach vorliegender Konzentration der Inhaltsstoffe und Lage des Objekts wird die Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 50929 als „sehr gering“, „gering“, „mittel“ und „hoch“ eingestuft. Dabei wird nach punktuellen Korrosionsangriff (Mulden-/Lochkorrosion) und flächenhaften Korrosionsangriff (Flächenkorrosion) unterschieden. Auch der Legierungsgrad von Metallwerkstoffen spielt bei der Beurteilung eine Rolle.
Читать дальше
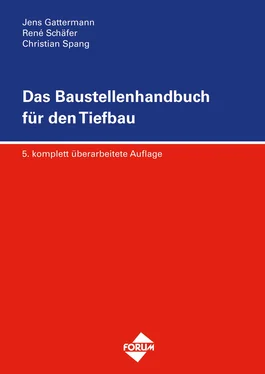
 3.3.2 Angriffsgrad von Grundwasser
3.3.2 Angriffsgrad von Grundwasser