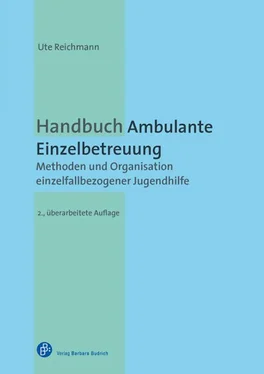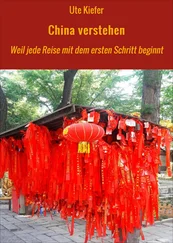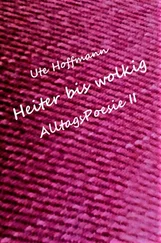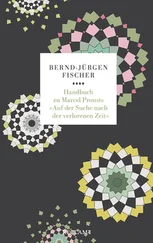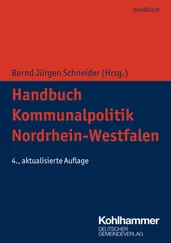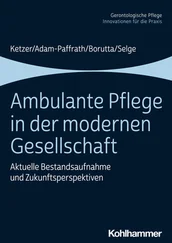Vom Reichsjugendwohlfahrtsgesetz bis zur Nachkriegszeit 7
In Deutschland wurden im 19. Jahrhundert wesentliche Meilensteine zum späteren deutschen Sozialstaat gesetzt. So bildeten sich große Wohlfahrtsverbände aus kirchlichen und gewerkschaftlichen Einrichtungen: 1848 war die „Innere Mission“ der evangelischen Kirche gegründet worden, 1897 der Caritasverband durch die katholische Kirche. 1868 gründeten sich der deutsche Gewerkschaftsbund wie auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) als großer Verband der Arbeiterbewegung. Charakteristisch für die deutsche Situation war das bismarcksche System der Sozialgesetzgebung und der Sozialversicherungen, die 1878–1889 formuliert und verabschiedet wurden. Auf diese Weise wurden nebeneinander starke verbandliche Wohlfahrtsstrukturen und ein weit entwickeltes, gesetzlich verankertes Sozialversicherungssystem geschaffen. Bis 1900 hatte sich die Jugendhilfe von der reinen Waisenpflege weiterentwickelt und auf straffällig gewordene und „verwahrloste“ Jugendliche und uneheliche Kinder ausgedehnt. Jugendhilfe und Armenhilfe differenzierten sich stärker aus und wurden zunehmend als unabhängige und unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen. Gegen 1910 entstanden Vorgängerinstitutionen der ersten Jugendämter wie die Mainzer Zentrale und die Hamburgische Behörde für öffentliche Jugendfürsorge.
In der Weimarer Republik wurde das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) als erstes deutsches Jugendhilfegesetz 1922 verabschiedet. Es trat am 1.4.1924 in Kraft. Auf seiner Basis konnten flächendeckend in den Kommunen Jugendämter als staatliche Institutionen zur Unterstützung und Überwachung familiärer Sozialisation und des Aufwachsens junger Menschen eingerichtet werden. Damit folgte man den Forderungen der Sozialreformer nach einer Vereinheitlichung und Bündelung aller Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendfürsorge.
Das RJWG bezog sich auf verschiedene Aufgaben: die Amtsvormundschaft für uneheliche Kinder, die Durchführung der Fürsorgeerziehung, die Subventionierung und Organisation der Jugendpflege und der Jugendgerichtshilfe und die Koordinierung der staatlichen und privaten Leistungen. In § 1 RJWG wurde auch das Recht eines jeden deutschen Kindes „auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit“[19]aufgenommen. Der Grundsatz der Subsidiarität, der bis in das heutige Kinder- und Jugendhilfegesetz Bestand hat, wurde kodifiziert. Er legt eine Nachrangigkeit der staatlichen Hilfen und Eingriffe gegenüber der familiären Erziehung und der nichtstaatlichen, d.h. verbandlichen oder freien Unterstützungsangebote fest. Dies bedeutet, dass das Jugendamt nur bei nachweislichem und schwerwiegendem Versagen der Eltern in familiäre Erziehung eingreifen darf und dass es nur dann selbst Hilfeangebote durchführen darf, wenn es keine freien oder verbandlichen Träger gibt, die diese Hilfen durchführen könnten.
Beide Aspekte von Subsidiarität werden immer wieder in Frage gestellt. So kollidiert auch heute bei Kindeswohlgefährdung und mangelnder Förderung von Kindern durch ihre eigenen Eltern der Wunsch nach mehr staatlicher Kontrolle und besseren Eingriffsmöglichkeiten mit dem verfassungsmäßigen Recht von Eltern, die Erziehung ihrer Kinder selbstbestimmt durchführen zu können. Die Subsidiarität der staatlichen Hilfen gegenüber den Angeboten der freien Träger wird ab und an als Interessenschutz für die starken Wohlfahrtsverbände kritisiert.
Nach Einführung des RJWG begann eine vorsichtige Ausdifferenzierung der Fürsorgeangebote nach Klientel und Problemintensität und ab 1928 nahmen niedrigschwellige Angebote wie die Schutzaufsicht an Anzahl zu (s.u.).
Parallel zum RJWG wurde das Reichsjugendgerichtsgesetz (RJGG) verabschiedet, das die bis heute grundsätzlich gültige Differenzierung zwischen Erwachsenen- und Jugendstrafrecht vornahm. Damit waren für straffällige Jugendliche gleichzeitig die Jugendämter (Jugendgerichtshilfe) und die Strafgerichte zuständig mit ihren jeweiligen Gesetzen, die unterschiedlichen Prinzipien folgten. Auch diese Dichotomie von sanktionsorientierter Strafjustiz und unterstützungsorientierter Jugendhilfe ist heute noch im Kinder- und Jugendhilfegesetz und Jugendgerichtsgesetz repräsentiert.
Durch Wirtschaftskrise und Inflation wurden die öffentlichen Ausgaben eingeschränkt und dies führte zu einer verzögerten Umsetzung des RJWG. Auch die organisatorische Abgrenzung von Jugendfürsorge und allgemeiner Wohlfahrt verlief schleppend. 1928 hatten von den 1251 bis dahin gegründeten Jugendämtern nur ein Drittel ihre Selbstständigkeit gegenüber den allgemeinen Wohlfahrtsämtern erreicht.
1931 gründete sich die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) und entwickelte sich nach 1933 zu einer der größten Massenorganisationen der Nationalsozialisten. Sie erhielt die Leitfunktion über die gesamte nichtstaatliche Wohlfahrtspflege. Die Jugendämter wurden durch Besetzung mit Funktionären der NS-Jugendverbände gleich geschaltet und für die nationalsozialistische Ideologie funktionalisiert. Diese NS-Organisationen übernahmen die sozialpädagogischen Aufgaben der Jugendämter. Junge Menschen integrierte man möglichst weitgehend in Hitlerjugend und Bund deutscher Mädels. Die neu geschaffenen Gesundheitsämter führten ab 1934 die Aufgaben der traditionellen Familienfürsorge und der Mütter- und Säuglingsberatung aus und unterstellten sie einer rassistischen Ausrichtung. Alle potenziellen Adressatinnen und Adressaten der Fürsorge, die sich in diese vereinheitlichende, totalitäre Linie nicht einordnen ließen und sich nachhaltig widerständig, nicht kontrollierbar und verhaltensauffällig zeigten, wurden ausgesondert, in konzentrationslagerähnlichen Einrichtungen wie dem Jugendschutzlager Moringen (für Jungen) oder dem Jugendschutzlager Uckermarck (für Mädchen) interniert und sogar als „lebensunwert“ ermordet. So wurde 1934 durch das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über das Maßregeln der Sicherung und Besserung“ die Möglichkeit eröffnet, sozial unangepasste Menschen einer „Vernichtung unwerten Lebens“ zu unterziehen (Rätz-Heinisch, Schröer, Wolff 2009: 23).
[20]In den 20er Jahren hatten Alice Salomon, die Gründerin der ersten sozialen Frauenfachschule in Deutschland, und der Fürsorgewissenschaftler Hans Scherpner die amerikanische Tradition der Case Work nach Deutschland gebracht (Müller 2006 4: 52f., Neuffer 1990: 67ff.). Andere, wie z.B. die jüdische Sozialarbeiterin und Fachschulgründerin Sidonie Wronsky, vertraten eine eher tiefenpsychologisch-therapeutische Ausrichtung der Sozialen Arbeit. Diese Traditionslinien waren durch den Nationalsozialismus in Deutschland zunächst unterbrochen. Doch nach Ende des 2. Weltkriegs führten die Amerikaner ein aufwändiges Austauschprogramm zur Umerziehung der Westdeutschen durch, bei dem auch erzieherische und sozialpädagogische Themen bearbeitet wurden. Auf diese Weise gelangten amerikanische Konzepte sozialpädagogischer Einzelfall- und Gruppenarbeit in der Nachkriegszeit nach Westdeutschland, z.B. durch Dr. Hertha Kraus, Professorin für Sozialforschung am Havenford College und deutsche Exilantin, die 1946 und 1948 als geladene Expertin für Soziale Arbeit Westdeutschland besuchte (Müller 2006 4: 165ff., Neuffer 1990: 67ff.). Sie veröffentlichte 1950 eine Übersetzung des Sammelbands „Casework in den USA. Theorie und Praxis der Einzelhilfe“. Im gleichen Jahr fand die V. Internationale Konferenz für Soziale Arbeit in Paris statt, zu der auch der Vorsitzende des deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge eingeladen wurde.
In den 50er Jahren etablierte sich Einzelfallhilfe neben Gruppenpädagogik und Gemeinwesenarbeit als wesentliche Methode Sozialer Arbeit und wurde in die sich langsam professionalisierende Ausbildung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Fachschulen für Sozialarbeit aufgenommen.
Читать дальше