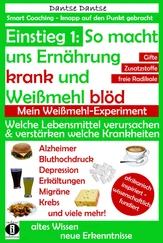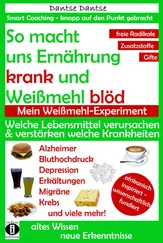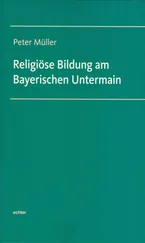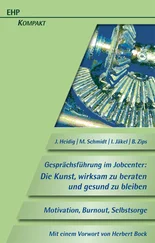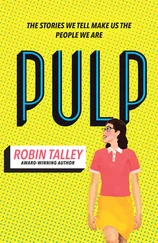was mit den kognitiven und (!) emotionalen Ressourcen verarbeitet werden kann.
Gerade hier findet sich die entscheidende Ergänzung zum Deutungsmusteransatz: Nicht allein kognitive, sondern auch emotionale Ressourcen bestimmen darüber, wie das Subjekt seine Wirklichkeit konstruiert. Die Tatsache, dass die Wirklichkeit nicht objektiv und unmittelbar zugänglich ist, führt wiederum zu dem Schluss, dass sich die Theorie- und Erwachsenenbildung von der „impliziten Erkenntnistheorie des Kontrafaktischen“ (ebenda, S. 44) lösen müsse und es weniger um das richtige als vielmehr das „viable“ Wissen, das was „wirkt“, geht. An die Stelle des Kontrafaktischen tritt nach Arnold das „Metafaktische“ (ebenda, S. 44), denn im Zentrum des Interesses steht weniger die Wirklichkeit an sich, als vielmehr die Beobachtung dieser Wirklichkeit, die eben von den kognitiven und emotionalen Ressourcen des Subjektes bestimmt wird. Es ist das Subjekt mitsamt seiner kognitiven und emotionalen Determiniertheit, das in seiner Beobachtung seine Wirklichkeit konstruiert und somit ist der Konstruktivismus nach Arnold nicht nur eine Beobachtungstheorie, sondern immer auch eine Subjekttheorie: „Die Beobachtungstheorie des Konstruktivismus stellt sich uns somit bei genauerer Betrachtung als eine Subjekttheorie – bzw. genauer: eine Theorie des erkennenden Subjektes – dar. Ihr Gegenstand sind die Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion durch Beobachtung, nicht die Wirklichkeit selbst“ (ebenda, S. 33).
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht nicht das Wissen oder die objektive Wirklichkeit, sondern das Subjekt und seine Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion durch Beobachtung. Der Deutungsmusteransatz sieht als Deutungsressource die kognitiven Deutungsmuster an, die im Rahmen der Sozialisation tradiert und lebensgeschichtlich auf Viabilität geprüft und weiterentwickelt werden oder sich ggf. als dysfunktional erweisen. Diese Deutungsmuster können als subjektive Orientierungen bezeichnet werden, die es im Kontext der Erwachsenenbildung zu differenzieren gilt, um dadurch ggf. eine Infragestellung, Anpassung oder Veränderung der Deutungsmuster zu erreichen. Nach Arnold kann die Wirklichkeitskonstruktion des Subjektes jedoch nicht hinreichend anhand dieser subjektiven Orientierungen erklärt werden, denn es fehlen hierbei die emotionalen Dynamiken, ohne die eine Wirklichkeitskonstruktion undenkbar wäre. Demnach muss nach Arnold an die Differenzierung subjektiver Orientierungen in Form der Deutungsmuster zwingend „ein Anschluß an die emotionale Individuierungslogik des Erwachsenwerdens und das dabei stattfindende Zusammenwirken kognitiver und emotionaler Differenzierungsprozesse“ (ebenda, S. 58) erfolgen. Demnach findet die Wirklichkeitskonstruktion des Subjektes immer auf der Grundlage des Zusammenwirkens kognitiver und emotionaler Differenzierungsprozesse statt und somit ist ein wirklicher Konstruktivismus konsequenterweise also immer ein emotionaler Konstruktivismus.
Emotionstheoretische Konzepte zwingen nach Arnold eine konstruktivistische Erwachsenenbildung geradezu dazu, den kognitivistischen Bias zu überwinden, da immer komplexere Einsichten darin gewonnen werden, welche „rekonstellierenden Kräfte“ (ebenda, S. 45) und „Strukturdeterminiertheiten“ (Maturana, zitiert in ebenda, S. 45) auf der Ebene der Gefühle die Akteure in einem erwachsenenpädagogischen Prozess bestimmen.
Zu diesen Einsichten zählen insbesondere die der führenden Emotionstheoretiker wie LeDoux (2006), Damasio (2000), Ciompi (1999), aber auch Roth (2001) und Singer (2002), die in Untersuchungen und Beobachtungen die Relation zwischen Kognition und Emotion ausloteten und aufzeigten, wie sehr jeder einzelne Mensch von seinen Emotionen bestimmt ist und wie sehr sich alte Emotionen immer wieder rekonstellieren: „Ist eine Situation bekannt, werden die alten emotionalen Erfahrungen abgerufen. Immer, wenn wir mit einer neuen Situation konfrontiert werden, wird gefragt: Was war in einer ähnlichen Situation meine vergangene Erfahrung? Und dabei entstehen Gefühle, und die sind nichts anderes als Kurzbotschaften aus meiner früheren Erfahrung. Diese Erfahrung könnte gar nicht in Worten wiedergegeben werden, weil wir zu viel erlebt haben. Gefühle können aber zugleich sehr differenziert sein: Tu das, aber sei vorsichtig dabei“ (Roth 2004, S. 142, zitiert in Arnold 2005, S. 1).
Somit deuten wir jede Situation im Licht einer zuvor erlebten Situation und der darin erlebten Erinnerungen und Gefühle, die quasi immer wieder aktiviert werden. In der Regel wird in einer Situation nicht auf externe Gründe reagiert, sondern die bereits verinnerlichten Deutungs- und Emotionsmuster rekonstelliert. Fraglich ist lediglich, ob die kognitiven Deutungsmuster oder die Emotionsmuster dabei die Wirklichkeitskonstruktion dominieren. Arnold nimmt hierbei (ebenfalls basierend auf den o. g. Emotionstheorien) klar Stellung: „Es spricht viel dafür, dass solche Mechanismen des Emotionalen die Wirklichkeitskonstruktionen des Menschen in einer noch sehr viel grundlegenderen Weise determinieren und rahmen als dies die biografisch erworbenen und ‚bewährten‘ Deutungsmuster tun, handelt es sich doch bei den Emotionen um unsere ersten, im vorsprachlichen Erleben verankerten Formen des ‚Sich-in-die-Welt-Fühlens‘, die als Orientierungsmuster in späteren Situationen dienen und in ihrer konstitutiven Kraft für das eigene Erleben und die Lebensgestaltung kaum unterschätzt werden dürfen“ (Arnold 2003a, zitiert in ebenda, S. 38). Die von Arnold hierbei in seinen Schriften häufig wiederholte Grundthese lautet, dass Menschen ihre Wirklichkeit nicht nur auf der Grundlage ihrer biografisch bewährten Deutungsmuster deuten, sondern „auch nach Maßgabe dessen, was sie auszuhalten vermögen“ (ebenda, S. 2).
Eine ganzheitliche Erwachsenenpädagogik muss demnach immer die Chance bieten, sowohl die kognitiven als auch die emotionalen Deutungsmuster zu reflektieren und zu transformieren. Arnold hebt eine solche Form des „transformativen Lernens“ von dem rein kognitiven Lernen ab und sieht damit sogar die Chance verbunden, eine Didaktik zu entwickeln, die die emotionalkognitiven Wechselwirkungen bei allen Akteuren im Lern-/Lehrprozess berücksichtigt und dabei den Gefühlen als „unseren ersten Verstand“ (Zimmer 1999, zitiert in ebenda, S. 38) zumindest annähernd den Stellenwert zukommen lässt, der ihnen gebührt. Wenn die Gefühle der „erste Verstand“ des Menschen sind, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass im Lern-/Lehrprozess die Selbst-, Beziehungs- und Situationsdefinitionen nicht „rational“ im Sinne eines Argumentationsaustausches und eines herrschaftsfreien Diskurses ausgehandelt werden, sondern (und dies gilt dann besonders für die Beziehung zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden und so auch für die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter) überwiegend auf der Grundlage von Gefühlen, die zeitweise geradezu irrational erscheinen mögen:
„Die emotionalen Matrixen stellen die Grundmechanismen der Konstruktion von Wirklichkeit bereit, Menschen reagieren deshalb grundsätzlich niemals nur realitätsangemessen, sondern beleuchten die sich ihnen stellenden Situationen mit Hilfe ihrer Gefühlslichter, da anderes nicht verfügbar ist. Ihr Verhalten in Führungs- und Lernsituationen kann deshalb auch nicht nur als Reaktion auf externe Anforderungen konzipiert werden, es ist vielmehr immer und stets zugleich eine Reaktion auf die eigene innere Systematik“ (ebenda, S. 7).
Insbesondere die beiden Interaktionsformen oder besser gesagt Beziehungsebenen Lernender – Lehrender oder Mitarbeiter – Leiter werden von einer inneren Systematik der Akteure mitbestimmt, weil die emotionalen Matrixen oder emotionalen „Einspurungen“ schon besonders früh erfolgen und sehr stark von den ersten prägenden Personen konstelliert und dann in späteren Situationen rekonstelliert werden:
Читать дальше