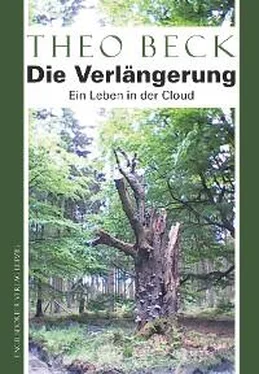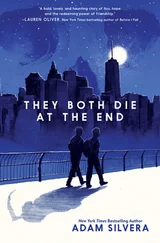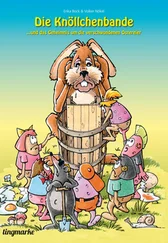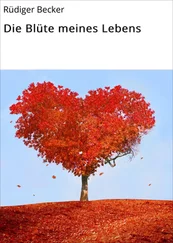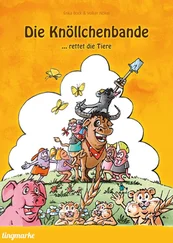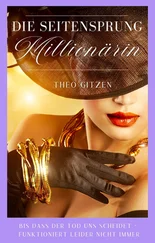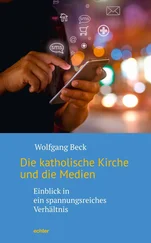Auch Hans bekommt auf der Hinfahrt seiner bemerkenswerten Reise nach Sizilien etwas davon mit. In Rom hat er einen halben Tag Zeit, sich die Stadt anzusehen. Und da steht er nun und staunt.
Ich verstehe das. Wer würde sie nicht bewundern wollen, die Pracht dieser Kirche, „Santa Maria Maggiore“, in Rom. Ich glaube, sie ist eine der vier Papstbasiliken und zugleich Pilgerkirche und gehört dem Vatikan. Ich schätze etwa fünftes Jahrhundert. Die Tafel, die Hans da liest, sagt, sie sei ein Denkmal des Marienkultes und zugleich Grabstätte mehrerer Päpste. Und sie liegt ganz in der Nähe vom Bahnhof Termini, von dem er gekommen ist. Die Engelsburg und die Brücke über den Tiber, die Hans aus der Oper Tosca kennt, sind weiter entfernt. Aber auf dem Platz vor der Basilika steht die Mariensäule, die, wie er gelesen hat, aus dem „Forum Romanum“ stammt. Und dass der Campanile der Kirche zu den höchsten Glockentürmen Roms gehört, hat er auch gelesen. Aber auch das: „Mit dem ersten Gold aus der Süd-Amerika-Beute ließ Papst Alexander VI. die Decke von Santa Maria Maggiore in Rom verzieren und mit dem Symbol seiner Familie versehen.“
„Pharisäer!“
Was, wie Pharisäer? Was hast du dagegen? Mich beeindrucken die Kirchen. Ja, von außen betrachtet, sind sie oft etwas bröckelig, oder sagen wir mal renovierungsbedürftig. Aber innen, mit den vielen Bildern, Fresken oder Mosaiken als Zeichen des Glaubens, die Insignien und so weiter, die sind doch bewunderungswürdig.
„Was begeistert dich daran?“
Na, also, zum Beispiel die Kleider und Umhänge in den Vitrinen mancher Kirchen. Das sind alles alte Originale, sorgsam gehütet, über Jahrhunderte, und kostbar bestickt.
„Ja. Und von wem bestickt? Wer hat die schneidern und besticken müssen? Wer hat das Material dafür liefern müssen? Die Träger bestimmt nicht! Sie hängen sich das Zeug um, nur um Eindruck zu schinden, um etwas Besonderes zu sein, um ihre Macht zu demonstrieren! Imitiert haben sie das meiste! Der Habit, wie sie das nennen, hat sich aus der Arbeitskleidung der Bevölkerung im Italien des sechsten Jahrhunderts entwickelt. Der Habit war äußeres Zeichen der Armut und des einfachen Lebens, mit dem sie sich auf die gleiche Ebene jener Menschen stellten, die sie überzeugen wollten. Der Habitus hat etwas mit Gesinnung und Verhalten zu tun. Der Träger dieser Kleidung brachte damit seine innere Einstellung zum Ausdruck. Wie früher die Mönche. In den Kirchen täuschten sie damit vor, sie seien so etwas wie Franziskaner oder Benediktiner. Aber von deren Vorbild der Einfachheit und Armut ist nicht mehr viel verblieben. Heute schmücken sich die vom heiligen Geist befruchteten Herren mit farbigen Umhängen als Rangabzeichen wie die Garde in einem Karnevalsverein, gefertigt und bezahlt von ihrem Fußvolk.“
Na, na! Und die Krone, die Mitra, Brustkreuz oder Krummstab, die Ringe, die sind doch alle echt, die ich da in der Vitrine gesehen habe.
„Ja, vermutlich. Nur auch hier: Wer hat sie so kunstvoll gefertigt? Die Bischöfe bestimmt nicht. Und von wem kommt das Gold? Jetzt schmücken sie sich damit, als wären es ihre Leistungen oder die ihrer Kirchen. Glaubst du, die Besitzer haben es ihnen freiwillig geschenkt? Man hat sie bestohlen und erpresst! Hieronymus, Bischof von Breslau‚ soll gesagt haben: ‚Wir brennen wahrhaftig vor Geldgier, und indem wir gegen das Geld wettern, füllen wir unsere Krüge mit Gold, und nichts ist uns genug.‘“
Und was war mit dem Handabhacken?
„Ich mag das nicht gerne erzählen, sieh doch selbst hin.“
Ja, den kenn ich, das ist Alfred Wessel. Er war Storekeeper auf der „MS Usambara“, ein spindeldürrer Mann von mittlerer Größe und etwa 45 Jahre alt. Als Storekeeper war er Vorgesetzter der Mannschaft, die zur technischen Besatzung gehört, also der Reiniger, Schmierer, Heizer und so weiter. Er und seine Leute wohnten nicht mittschiffs wie die nautischen und technischen Offiziere und ihre Assistenten, sondern achtern, unter der Poop. Sie hatten dort zusammen mit dem Bootsmann, Zimmermann und der übrigen Decksmannschaft eine Mannschaftsmesse, in der sie von den Schiffsjungen bedient wurden. Und sie alle mochten den Storekeeper, weil er gut erzählen konnte.
Alfred Wessel fuhr schon lange zur See, sagte er, eigentlich seitdem er zu den Erwachsenen zählte. Aber er hat immer wieder mal eine Pause eingelegt, einen Zwischenstopp für Abenteuer, sagte er. Wenn sich ihm die Chance bot, irgendwo auszusteigen, an einem Ort oder in einem Land, das ihn interessierte, hat er das getan, sagte er. Und das war die Ursache, warum er viel zu erzählen hatte. Zur Freude der Schiffsjungen. Und eine Geschichte war die vom Handabhacken. Er hatte ein handgebundenes, schmales Heft darüber verfasst, DIN A4, mit einem blauen Pappeinband und auf blauem Luftpostpapier in Schreibmaschinenschrift beschrieben. Dieses Erlebnis konnte er also vorlesen. Das fiel ihm leichter.
„Das Gefängnis von Mekka ist ein großer, viereckiger Bau ohne Fenster nach außen. Es ist ein Ringgebäude, das man durch ein eckiges, schmuckloses, eisernes Tor betritt, durch das man in den großen, sandigen Innenhof kommt. In den allermeisten Fällen fährt man durch das Tor. Auch mich hat man hierhergefahren. In einem Polizeiwagen. Der hielt dann direkt vor dem Gebäudeeingang an der Innenseite, so nahe, dass die Gefangenen nicht gesehen wurden, die angeliefert wurden. Vermutlich war das Absicht, denn die Insassen hingen häufig vor ihren vergitterten Fenstern und sahen auf den Hof. Ich auch.
Es war eine schmutzig-graue, bröckelige Fläche, eine Kreisfläche von etwa sechzig Metern Durchmesser in der Mitte, eher einem ungepflegten Spielplatz ähnlich als einem Gefängnishof. Einmal am Tag, meistens abends, konnten ausgewählte Gefangene den Platz betreten und dort spazieren gehen. Natürlich nicht alle. Das wären zu viele gewesen. Ich schätzte sie auf vierhundert. Aber genau wusste ich es auch nicht, als ich dort eingesperrt war. Man hatte mich erwischt.
Es war mein schon lange gehegtes Ziel gewesen, einmal nach Mekka zu pilgern. Die Stadt liegt, wie man weiß, in Saudi-Arabien, in der Region Hedschas, und sie ist die heiligste Stadt der Muslime. Jedes Jahr pilgern mehrere Millionen von ihnen dort hin. Und das wollte ich auch. Ich hatte mir die landessüblichen Kleider besorgt und saß auf der Ladefläche eines Pickups, der mich von der Küste aus in die Stadt mitnehmen sollte. Bezahlen musste ich ihn gleich am Anfang. Da hatte der Fahrer mich bereits danach gefragt und ich hatte ihm versichert, dass ich Muslim bin.
Ich war in Dschidda ausgestiegen, hatte mir die Stadt angesehen. Es ist eine große Stadt und eigentlich wollte ich wieder an Bord. Aber Dschidda ist seit dem siebten Jahrhundert das Tor nach Mekka und für alle Religionen offen. Im Gegensatz zu Mekka. Und zu der Zeit war gerade Hadsch. Das war nicht zu übersehen. Im Hafen kamen Tausende und Abertausende an, in Schuten, Booten, Bussen, Transportern und anderen Fahrzeugen, und suchten Fahrgelegenheiten für die etwa achtzig Kilometer bis Mekka. Da hatte ich die Idee, das auch zu machen. Das war mal was Besonderes, dachte ich.“
Storekeeper Wessel sieht kurz von seinem Buch auf, als wollte er sich versichern, dass auch alle gut zuhören.
„War das auch. Kurz vor Mekka stand ein großes Schild quer über der Autostraße. ‚Muslims only‘ war geradeaus, ‚For non muslims‘ ging rechts ab. Mein Fahrer fuhr geradeaus. Da war es zu spät für mich umzukehren.
Natürlich war mir bekannt, dass Mekka eine verbotene Stadt ist. Was ich nicht wusste, war, wie ernst das gemeint war. Da in der Gegend nimmt man ja auch anderes nicht immer so genau, dachte ich mir. Vor der ersten Straßensperre kroch ich unter die Plane, die die Ladung abdeckte. Es waren Kartons mit Wasserflaschen. Viele. Wenige Minuten nachdem wir weitergefahren waren, hielt der Fahrer auf einem kleinen Platz, wo nicht so viele Leute waren, und ließ mich aussteigen. Ihm war die menschliche Fracht wohl nicht ganz geheuer.
Читать дальше