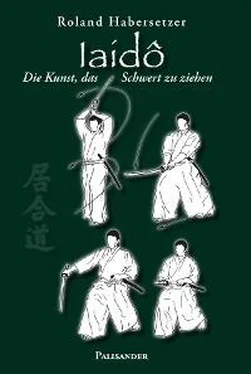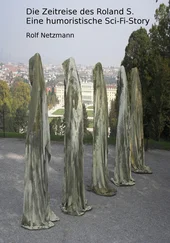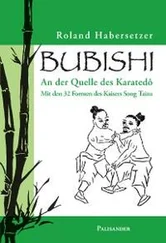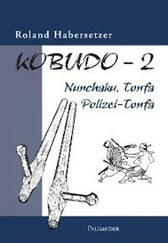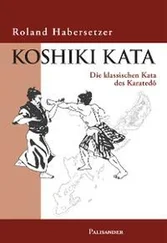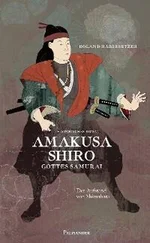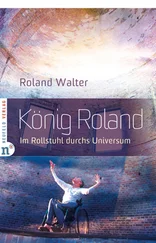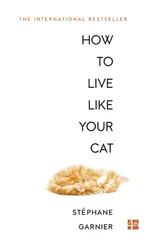Der Autor Hanshi Roland Habersetzer Roland Habersetzer Centre de Recherche Budo – Institut Tengu (CRB-IT) 7b, rue du Looch 67530 Saint-Nabor (Frankreich) www.tengu.fr Deutsche CRB-IT Website: www.wslang.de/karatecrb/
Illustrationen Illustrationen Alle Zeichnungen und Bildtafeln entstammen der Feder des Autors, mit Ausnahme der Zeichnungsfolge auf S. 140 bis 144, deren Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Weinmann-Verlags, Berlin, erfolgte. Fotos auf S. 5 Hanshi Roland Habersetzer Roland Habersetzer Centre de Recherche Budo – Institut Tengu (CRB-IT) 7b, rue du Looch 67530 Saint-Nabor (Frankreich) www.tengu.fr Deutsche CRB-IT Website: www.wslang.de/karatecrb/ (Autorenfoto), S. 23 , 39, 152 und 153: Roland Habersetzer. Foto auf S. 16 : Budo magazine (mit freundlicher Genehmigung). Fotos auf S. 21 , 38 und 60 : Jean-Pierre Raick (mit freundlicher Genehmigung). Foto auf S. 49: Martial Arts International (mit freundlicher Genehmigung). Fotos auf S. 46 und 47: Eugène Crespin (mit freundlicher Genehmigung). Foto auf S. 146 : Kendo-nippon (mit freundlicher Genehmigung). Foto auf S. 42: gemeinfrei. Abbildung auf S. 81: gemeinfrei.
Das Wesentliche in wenigen Worten Indem man zieht, pariert man den Schlag des Gegners und versetzt ihm einen Hieb, in dem die ganze Seele liegt, so dass er zu Boden fallen wird. Yoshimura Kenichi
1. Der Geist: Ein Augenblick, der über Leben und Tod entscheidet
1.1. Iaijutsu: Angreifen beim Ziehen des Schwertes
1.1.1. Battōjutsu oder kenjutsu – die ersten »Wege« des Schwertes
1.1.2. Hayashizaki Jinsuke, der Vater des iaijutsu
1.2. Iaidō: Eine klassische Kunst
1.2.1. Vom Tokugawa-Frieden zu den seitei-iai-gata
1.2.2. Die heutigen traditionellen Schulen (ryū-ha)
1.2.2.1. Musō Shinden-ryū
1.2.2.2. Mugai-ryū
1.2.2.3. Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
1.2.2.4. Takenouchi-ryū
1.2.3. Iaidō oder Iaijutsu?
1.3. Sich selbst angreifen
2. Die Technik: Zen Nippon Kendō Renmei Iai
2.1. Die Elemente
2.1.1. Die Stellung (physische Elemente: tai)
2.1.2. Das kihon (technische Elemente: gi)
2.1.2.1. Koiguchi-no-kiri-kata
2.1.2.2 Nuki-tsuke
2.1.2.3 Seme
2.1.2.4 Furi-kaburi
2.1.2.5 Kiri-tsuke
2.1.2.6 Chiburi
2.1.2.7 Zanshin
2.1.2.8 Noto
2.1.3. Die innere Haltung (geistige Elemente: shin)
2.2. Die kata
2.2.1. Etikette und Zeremonie (reishiki)
2.2.1.1. Der Geist des dōjō
2.2.1.2. Der Gruß
2.2.2. Beschreibung der zwölf Formen
2.2.2.1. Tabellarische Übersicht
2.2.2.2. Die erste Form: Mae
2.2.2.3. Die zweite Form: Ushiro
2.2.2.4. Die dritte Form: Uke-nagashi
2.2.2.5. Die vierte Form: Tsuka-ate
2.2.2.6. Die fünfte Form: Kesa-giri
2.2.2.7. Die sechste Form: Morote-zuki
2.2.2.8. Die siebente Form: Sanpō-giri
2.2.2.9. Die achte Form: Gan-men-ate
2.2.2.10. Die neunte Form: Soete-zuki
2.2.2.11. Die zehnte Form: Shihō-giri
2.2.2.12. Die elfte Form: Sō-giri
2.2.2.13. Die zwölfte Form: Nuki-uchi
2.2.3. Der Geist des iai
Anhang
Die Ausrüstung
Die Kleidung
Die Waffe
Tameshi-giri
Die kata des iaidō des Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
Aussprüche von Meistern des katana
Kendō- und Iaidō-Verbände
Weitere Titel
Anmerkungen
Indem man zieht, pariert man den Schlag des Gegners und versetzt ihm einen Hieb, in dem die ganze Seele liegt, so dass er zu Boden fallen wird.
Yoshimura Kenichi
Das Wesentliche in wenigen Worten
Plötzlich verharrt der Meister in seinem leisen, gemessenen Gang. Würdevoll und aufrecht steht er da in seinem dunklen hakama , mit vollkommen gleichmütigem Gesichtsausdruck. Seine linke Hand hält den Schwertgriff auf Höhe der Hüfte, die Schneide der Klinge zeigt nach oben. Dies ist der Augenblick, in dem die physische und geistige Konzentration extrem wird, fast unerträglich, der Moment, in welchem der Gegner sein eigenes Schwert schwingen wird, um sich in den Angriff zu stürzen. Die Aktion wird bis zum letztmöglichen Augenblick hinausgezögert, bis zu der nunmehr greifbar gewordenen Grenze zwischen Leben und Tod. Was nun folgt, hängt an einem seidenen Faden: Das leiseste Geräusch, die erste sichtbare Bewegung, und alles in dieser äußersten Konfrontation zweier Gegner wird zu Ende sein. Das Gesicht des Meisters gleicht noch immer einer undurchdringlichen Maske, aber die Luft scheint von dieser scharfen Konzentration zu vibrieren, zu der die Männer nur in diesem entscheidenden Moment wirklich fähig sind, in dem einer von ihnen sterben muss, damit der andere überlebt. Denn im Angesicht des Todes kann auch die kleinste Geste zu größter Bedeutung gelangen.
Plötzlich entlädt sich die angesammelte Energie. Das ki 1 explodiert und verschmilzt mit der Schnelligkeit des katana , das aus seiner Scheide fährt gleich einem kalten, bläulichen Blitz. Die Klinge schießt mit einem seidigen Geräusch durch die Luft, von hinten nach vorn und trifft den Gegner genau in dem Augenblick, in dem er dem Angriff ausweichen will. Der Meister, der seine Spannung auf solch außerordentliche Weise schlagartig losgelassen hatte, hält abrupt in seiner Bewegung inne, wobei er einen durchdringenden kiai 2 ausstößt. Das Schwert steht still; der Kampf ist beendet.
Diese unvermittelte Rückkehr in den Zustand der Ruhe bildet den schärfsten Kontrast zur Intensität der gerade erfolgten Handlung; der Gegner liegt bereits am Boden, mit gespaltenem Schädel oder durchtrennter Kehle, möglicherweise auch mit zerschnittener Kniekehlensehne. Mit einer knappen Bewegung aus dem Handgelenk schüttelt der Meister das Blut, das die Klinge benetzt, ab und steckt das katana schnell, aber keineswegs hastig zurück in die Scheide. Dies geschieht mit Maßgefühl und Präzision, mit einer Bewegung, die von Kraft und Meisterschaft spricht.
Auch heute noch werden Iaidō -Vorführungen mit Neugierde und Bewunderung verfolgt. Der Meister, allein in einem imaginären Kampf auf Leben und Tod mit einem unsichtbaren Gegner, fasziniert den Zuschauer, denn in den Bewegungen der kata 3, die er ganz für sich ausführt, und selbst in seinem gelegentlichen Innehalten vor, bei und nach dem tödlichen Schlag, schimmert der Geist des echten budō 4 hindurch.
Das iai hat heute nicht mehr den geringsten praktischen Nutzen, denn die Techniken mit dem Schwert können keinen Zweck mehr erfüllen, nicht einmal im Sinne einer technischen Überlegenheit über einen Partner in einem sportlichen Wettkampf. Doch gerade darum ist alles an ihm so rein geblieben – der Geist, die Haltung, der Schlag, die Absichten und ihre Umsetzung. Es ist ein Kampf des Menschen gegen sich selbst. Doch der Meister des iaidō wird sagen, es ist ein anderes Selbst, gegen das der Schlag geführt wird. Und ebenso wie auf verschiedenen spirituellen Wegen, so beispielsweise im Zen, wird der Meister seinen Schüler lehren, das besitzergreifende »Ego« aufzugeben, den Teil des Selbst, der einen hemmt und einem Illusionen vorgaukelt. In den Techniken des iaidō wird auf alles Überflüssige verzichtet, und auf diese Weise lehrt es seinen Adepten, das Überflüssige in sich selbst fallenzulassen.
Im Ausdruck » iai« findet sich der Begriff des »Seins« ( i , von iru ) und der Begriff der Harmonie ( ai ) in dem Sinne, dass man seinen Geist in Harmonie mit dem des Gegners bringt. Dies erinnert an die Kunst des aikidō . Aber im Unterschied zu diesem ist im iaidō die entsprechende Geisteshaltung mit der Meisterschaft im Umgang mit einer Waffe, dem Schwert der Samurai von einst – dem katana – verbunden. Die präzisen Bewegungen mit dieser Waffe sind nichts anderes als die Verlängerung dieser Geisteshaltung. Die Nachsilbe » dō« , der Weg bzw. die Suche, ist mit dem chinesischen Begriff » dao« identisch und weist auf die spirituelle Komponente in einer kriegerischen Praxis hin, wie dies in allen japanischen Kampfkünsten (den Künsten des budō ) der Fall ist. Sie bezeichnet ein Endziel, das über den einfachen Gebrauch der Techniken hinausgeht. Im Lauf der Zeit ist aus dem iai-jutsu , der »Technik« des iai , das iai-dō , der »Weg« des iai , geworden. Die Kunst des iai , das heißt, die Kunst des Schwertziehens in einer Bewegung, in der Ziehen, Schnitt, Hieb und Stoß ineinander verschmelzen, war lange Zeit eine pure Kampftechnik. Erst später entwickelte sie sich zu dem, was es heute ist, einem inneren Weg für denjenigen, der eine Bewegung ausführt, die man nicht mehr als Kampftechnik auffassen muss.
Читать дальше