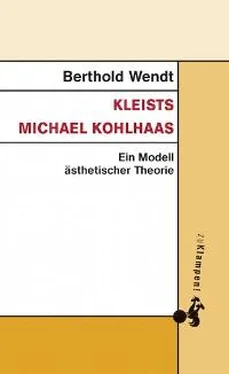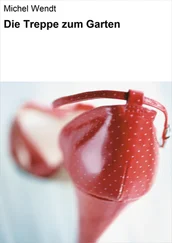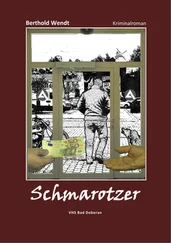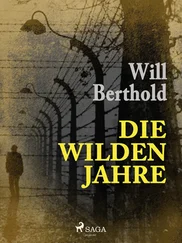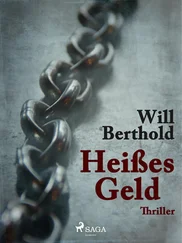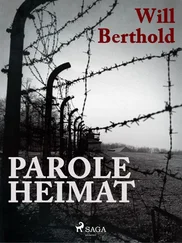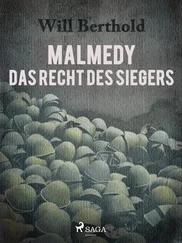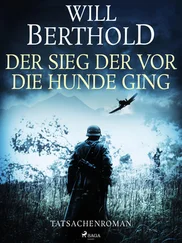Unter 5) Wertungsfragen: Protagonist, Erzähler und Leser lässt sich der kleine Aufsatz von Karl Philipp Ellerbrock mit dem Titel Wasser und Eloquenz 51 einordnen, der sich mit dem Motiv des Wasserausschüttens in der Abdeckerszene befasst und darin wird feststellt: »Entscheidend ist jedoch, dass in der Abdeckerszene Geste und Handlung zuletzt über das gesprochene Wort triumphieren.«52 Wie Ellerbrock motivgeschichtlich nachzeichnet, eröffnet die Geste des Abdeckers »einen Deutungshorizont für das Geschehen, indem sie alle Rede verwirft und eine Rückkehr in das alltägliche Leben vorstellbar macht.«53 Die detaillierte Analyse der Abdeckerszene in meiner Arbeit kommt zu anderen, nicht so optimistischen Resultaten.
Ganz allgemein ist aus der Sicht meines Forschungsansatzes zu den Wertungsfragen, die in fast alle Beiträge zum Kohlhaas hineinreichen, Folgendes zu sagen: Es ist das hermeneutische Anliegen dieser Dissertationsschrift aufzuzeigen, dass die Beurteilung des Handelns des Protagonisten, dessen Bedingungen und Maximen in Kleists Text immer wieder selbst reflektiert werden, nicht aus der Gesamtbetrachtung des ästhetischen Verlaufs der Handlung abgelöst werden kann, sondern als Moment dieses Handlungsverlaufes und seiner Formbestimmungen betrachtet werden muss. Die Isolation einzelner Extremhandlungen oder die Identifikation eines bestimmenden Charakterzuges (etwa die vielerwähnte Rachsucht) erscheinen dem hier angewandten Verfahren gegenüber – selbst wenn sie partiell zutreffen – als verkürzende Personalisierungen.
Zur Problematik der Gewalt und des Erhabenen:
In Iris Dennelers Aufsatz: Kleists Bankrotterklärung des Erhabenen 54 ist, nach der aus der Rhetorik stammenden engen Definition, das Erhabene im Wesentlichen identisch mit dem Heroischen und Dramatischen. Die sog. Bankrotterklärung wird aber, auf die Schiller- und Kant’sche Bestimmung des Erhabenen zielend, über eine angebliche Destruktion der »Allianz von Ordnung, Sittlichkeit und Vernunft durch die Aufklärung«55 begründet und mündet in einem blinden Opferwillen: »Auch der Leser kann angesichts der ständig wechselnden Erzählperspektiven keinen souveränen Standpunkt mehr gewinnen, sondern muss blind für die Werte- und Normenangebote des Erzählers ›in Grund und Boden‹ gehen.«56 Kleists Sprache ist Iris Denneler Beleg sowohl für einen zugleich das eigentliche »Begehren« verdeckenden Ausbruch in Gewalttätigkeit als auch für Kleists »Kriegserklärung gegen die Gesellschaft«57 und eben gegen das bürgerliche Vertrauen in das Erhabene als ästhetische Aufrufung der Vernunftideen. »Kleists Stil ist in seiner Monstrosität außergewöhnlich. Grauenhafte Szenen korrespondieren mit einer Gewalttätigkeit im Satzbau und in der Wortwahl, die geradezu von einer Vergewaltigung des syntaktischen und morphologischen Bestandes sprechen läßt: Sperrungen, Schachtelsätze und wie auf einer Folterbank gedehnte Perioden sind Kennzeichen der gewaltigen und gewalttätigen Sprache Kleists. Das Konkrete ist weniger die so paradoxe und undurchschaubare Realität, als die Körperlichkeit der Sprache, die sich in extremer Detailtreue, in voluminösen Sätzen, in einer Ästhetik der Intensität Luft verschafft. Kleists Sprache – eine Rhetorik des Terrors. Der Dichter, so erkannte Karl Heinz Bohrer, war weniger ›am moralischen Gehalt von Emotionen interessiert, sondern an ihrem sozusagen energetischen Ablauf überhaupt‹.«58 Um diese sprachliche Mordlust glaubwürdig zu machen, musste sich der Künstler zum Beweis selbst gewaltsam zu Tode bringen: »Seine rhetorische Gewalt zerstörte und legitimierte sich im Akt der Selbstexekution, der letzten, möglichen Form der Heroik des modernen Subjekts. Der Autor Kleist führte vor, was seine Leser nicht verstehen wollten, nämlich die Kunst ›sich aufzuopfern, ganz für das, was man liebt, in Grund und Boden zu gehen‹«59. Hätte Denneler Recht, so hätte schon Goethe mit seiner Einschätzung der Kleist’schen Werke richtig gelegen. Dennelers Gesellschaftskritik ist angesichts ihrer undialektischen Vernunftkritik politisch fragwürdig. Und problematisch ist ebenfalls ihr interpretatorischer Umgang mit Kleists Sprache. Denn die Isolation der Sprache und der von Kleist verwendeten Mittel gegen das durch sie ästhetisch zum Ausdruck Gebrachte trifft die methodische Entscheidung, die sprachlichen Mittel eines Kunstwerkes seien gegenüber dem Darzustellenden beliebig oder austauschbar und ihre Verwendung beruhe auf einer dezisionistischen Wahlfreiheit des Autors. Kleist habe also, so wird unterstellt, die Freiheit gehabt, dem Gewaltsamen, das er zu charakterisieren versuchte, auch auf sprachlich sanfte, harmonische und glattere Weise Ausdruck verleihen können, ohne den Sachverhalt zu verklären oder eben die jeweilige Bedeutung der Gewaltausübung, die es ihm herauszuarbeiten ging, zu verfälschen. Dennelers Auffassung wird von der Saussure’schen Sprachtheorie mit ihrer These von der Arbitrarität der Zeichen nahegelegt. Gälte diese Theorie unumschränkt, dann schlösse dies die Möglichkeit sprachlicher Kunst aus, da Sprachkunstwerke, deren Material die Sprache ist, dann nicht mehr mimetisch sein könnten. Denn Mimesis verlangt, dass das Material zum Sprechen gebracht werden kann, m. a. W., dass das Material Ausdrucksträger des Gehaltes wird, der, wie Adorno sagt, als Geistiges, an seinen »Ort im Phänomen«60 gebunden ist. Mit dem Hinweis auf das Übersetzungsproblem von Sprachkunstwerken in eine andere Sprache lässt sich wohl am leichtesten demonstrieren, dass die Zeichen des Bezeichneten in Kunstwerken nicht einfach arbiträr sind, denn dann wäre ihre Übertragung ein fast mechanisches Unterfangen.
Es verhält sich nicht viel anders als bei den Wertungsfragen, wenn die Sprache aus Textpassagen als Kleists Individualstil identifiziert oder als eine Art zeitbedingte Espéce isoliert wird, anstatt sie sowohl als spezifischen kontextuellen Ausdrucksgehalt zu analysieren als auch sie im Zusammenhang des Werkganzen in Beziehung auf das Erhabene bei Kleist zu setzen. Träte nämlich der Autor in der Bemühung um den Ausdruck der Sache ganz hinter diese zurück oder ginge seine Persönlichkeit ganz in ihr auf, dann wäre ganz unabhängig von der persönlichen psychischen Struktur des Autors oder seiner wie immer auch gearteten Weltsicht, nach der aktuell für das kritische Selbstbewusstsein aussagekräftigen ästhetischen Wahrheit seiner Werke und der als deren Moment in ihnen gestalteten gewaltsamen Szenen zu fragen. Löst man aber, wie Denneler, die Sprache von ihrer Verschränkung mit dem Gehalt los, dann ist eine in ihren gewöhnlichen Regeln gebrochen und also gewaltsam verwendete Sprache, die dadurch zum mimetischen Ausdruck des in ihr Gestalteten wird (so wie bei Kleist, vgl. meine Analyse von Herses Verhör im Kapitel B 05), nicht von einer Sprachverwendung zu unterscheiden, bei der sich die Deformation des Sprachleibes mit dem Ausdruck tatsächlich nicht mehr verträgt, sondern sich willkürlich verselbständigt.
Folgt man Denneler und geht es in poetischen Werken nicht mehr um die Angemessenheit der Sprache an den jeweiligen Sachverhalt61, also hier das Wie der Kleist’schen Sachlichkeit62, dann wird der Möglichkeit nach die Gewaltsamkeit eines Sachverhaltes, den sie angemessen in Worte zu fassen versucht, zu ihrer Schuld, denn sie hätte ihn ja auch mit ganz gegenteiligen, also gewaltlosen Sprachformen zur Darstellung bringen können. Damit wird implizit der ästhetischen Sprache vorgeworfen, dass sie nicht verklärt. Dennelers Charakterisierung der gewaltsamen Sprache gehorcht dann einem Schema von Anpassung, denn eine Sprache, die durch Monstrositäten nach dem Ausdruck des Ungeheuerlichen trachtet, erinnert mimetisch an Missstände, und nach dem Schema von Identifikation und Projektion wird, wer an Missstände erinnert, persönlich für sie verantwortlich gemacht und/oder als Defätist beschimpft. Weil er den kollektiven falschen Schein durchschlägt, gilt er als Verursacher des Übels, dem er jedoch nur den richtigen Namen gibt, d. h. ihn in passende Sprache setzt. Damit wird dann nicht nur das Leiden, sondern selbst noch sein sprachlicher Ausdruck verdrängt. An der disziplinierenden Struktur dieser Argumentationsweise ändert gewiss auch nichts, dass Denneler anscheinend die von ihr analysierte Gewaltsamkeit als Kritik bürgerlicher Vernunft gutheißt.
Читать дальше