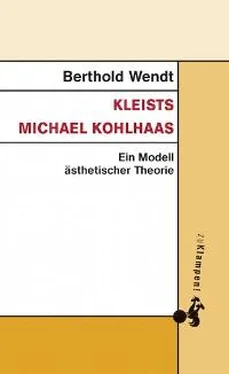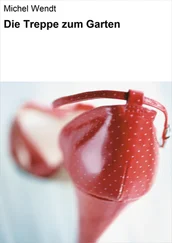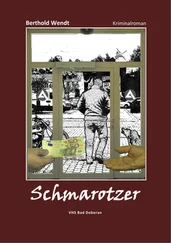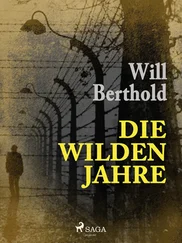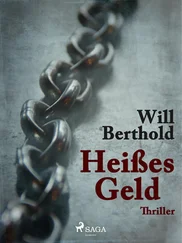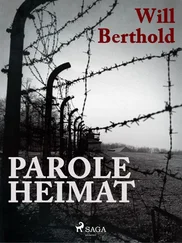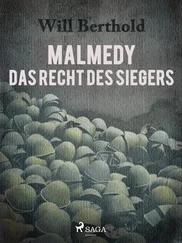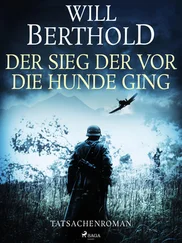Chr. Künzel hat gezeigt, dass man durch Fundierung der Interpretation mit dem Begriff des Kaufmanns einen identischen Begriff eines Sozialcharakters als identische Basis entgegengesetzter Bestimmungen zu Grunde legen kann, der den in der Erzählung dargestellten Prozess zu dessen Bebilderung oder tautologischen Bestätigung macht.
Zu 4) Naturrecht und Gerechtigkeit
Als Problemaufriss und Exponierung der Herangehensweise meiner Arbeit sei hier einleitend der Aufsatz von Joachim Rückert von 1988/8934 diskutiert, der den mir als zuverlässigsten erscheinenden Überblick über die Rechts- und rechtsphilosophische Geschichte um 1800 gibt. Gerade in der Frage des persönlichen Widerstandsrechts auf dem Hintergrund des damals allgemein bekannten Gedankens vom Gesellschaftsvertrag stellt er zwei gegensätzliche Strömungen heraus: die der prinzipiellen Ablehnung und die der bedingungs- und ausnahmsweisen, geregelten Zulassung eines Widerstandes gegen den Staat. Die Seite der Ablehnung bezieht ihre Berechtigung aus dem allgemeinen praktischen Prinzip, also dem Recht als dem gegenüber allen Einzelnen verselbständigten Allgemeinen, und lädt die Kosten seiner ausnahmsweisen Fehlbarkeit dem Einzelnen auf (der zu dulden habe); die andere Seite bekennt sich zum Einzelnen und begründet aus seiner Pflicht gegen sich selbst, die ihm Aufopferung verbietet, ein Recht auf Gewalt gegen die Angriffe gegen seine Rechte. Eine biographisch und rechtsgeschichtlich angelegte Interpretation versucht nun, unter Auffindung eines Gewährsmannes, eine Theorie zu finden (bei Rückert sind dies die Schriften von Ludwig Heinrich Jakob), die es ermöglicht, das Handeln des Protagonisten des Kohlhaas mit rechtsphilosophischen Theorien als in Übereinstimmung befindlich zu erklären. Dies ist im ersten Schritt sinnvoll, insofern es dazu helfen kann, die konsequente Durchgestaltung des Textes nach seinem idealischen Geist verständlich zu machen. Doch hat es zwei Grenzen: a) die eine ist die, wo der Text vermöge der Wechselwirkung zwischen geistiger Form und Stoff aus den Schranken der Rechtsphilosophie ausbricht und das Verhältnis zur Moral thematisiert. Rückert hat diese Grenzüberschreitung sehr sorgfältig an der Begriffsgeschichte des »Rechtgefühls« als eines moralischen Gefühls nachgewiesen35. Und b) darin, dass es sich bei dem rechtsphilosophischen Problem um eine Antinomie handelt36, die innerrechtlich nicht zu lösen ist und die ihren Grund in der Unmöglichkeit hat, Recht als Erweiterung der Moral zu begründen. Eben diese Antinomie und ihr Grund werden in der Erzählung Kleists ästhetisch entwickelt. Zu ihrer theoretischen Darstellung als Grundlage der Interpretation ist es notwendig, nicht einzelne historische Positionen zu referieren, sondern das Verhältnis von Recht und Moral an dem dafür sachlich einschlägigen, zudem das Denken seiner Zeit zusammenfassenden Text, Kants Metaphysik der Sitten , zu diskutieren, wie es in dieser Arbeit im Kap. A.03 geleistet wird.
Hans Richard Brittnacher äußert sich in seinem Aufsatz Das ›Rechtgefühl einer Goldwaage‹ oder: Kohlhaas läuft Amok 37 zur Frage der Gerechtigkeit, ausgehend von der »Kombination der Superlative von ›rechtschaffen‹ und ›entsetzlich‹.«38 Brittnacher diskutiert das Verhältnis von Rechtsverletzung und Rache und konstatiert pazifistisch: »Aber dem Skandalon des ›zugleich‹, wie es die Lektüreanweisung des Erzählanfangs insinuiert, ist keine dieser Lektüren gewachsen, unterstellen sie doch, dass die Novelle sich zuletzt, […], auf eine Seite der Gewalt schlage – sei es die persönlich verständliche, aber nicht rechtsförmige, sei es die staatlich legitimierte, aber ungerechte.«39 Nun sieht Brittnacher, dass die Erzählung selbst Partei nimmt: »Wie man es auch drehen und wenden mag – bei allem Für und Wider scheint die Erzählung doch ja zu sagen zu der Grandiosität des Kohlhaas und zum Exzess seiner Rache.«40 So vorsichtig dieser Befund bei Brittnacher formuliert ist, geht er doch mit meiner Deutung konform. Doch dann nimmt seine Interpretation eine überraschende Wendung, denn die Lösung dieser parteilichen Schieflage sieht Brittnacher im Amoklauf. »Wenn aber die Macht blind ist, dann kann auch die Rache derer, die aufbegehren, nicht präzise gerichtet sein. […]. Die Selbstermächtigung zum Racheengel und zum Souverän einer provisorischen Weltregierung ist die Metapher für die Pathologie eines Helden, den die Anomie der Verhältnisse zu einem unberechenbaren Täter werden lässt, der rot sieht: Kohlhaas läuft Amok.«41 Überraschend ist an der These vom Amoklauf, dass die von Brittnacher selbst aufgeführten Merkmale einer solchen Tat, insbesondere Einzeltäterschaft und Wahllosigkeit, auf Kohlhaasens zielgerichteten, bewussten und gut organisierten Rachekrieg ganz und gar nicht zutreffen. Von einem Fortschritt der Forschung kann nicht gesprochen werden, weil, abgesehen vom Text, schon 1984 Horst Sendler in seiner Kritik einer These von Günter Blöcker (1960) die Rede vom »Amokläufer des Rechts«42 begründet abgewiesen hat. Bei Brittnacher wird die Kohlhaas -Erzählung zur Warnung an moderne Gesellschaften: »Auch in dieser Hinsicht (der Reaktion von aufgebrachten Menschenmassen, B. W.) deutet sich im Amoklauf des Michael Kohlhaas ein bis dahin unbekannt gebliebenes, spezifisch modernes Risiko an, die Drohung einer neuen Form von Gewalt, die am Ende der Erzählung in Zucht genommen wird.«43
Da Hamacher unter 4) auch die Kontroverse um Luther abhandelt, so ist hier der Beitrag von Claus-Dieter Osthövener: ›Die Kraft beschwichtigender Worte‹ 44 zu erwähnen. Osthövener bemüht sich, insbesondere in der Kritik der Luther-Darstellung bei Jochen Schmidt, die beschwichtigende Rolle Luthers auf der Grundlage von dessen seelsorgerischem Religionsverständnis herauszustellen. »Denkt man sich (aus Luthers Plakat im Kohlhaas , B. W.) die heftigen Kraftausdrücke einmal hinweg und ermäßigt die eschatologische Temperatur, dann ist das Plakat nicht mehr gar so weit von dem ruhig ermahnenden Seelsorgerschreiben Luthers an den historischen Kohlhase entfernt.«45 Hierbei wird auch das Motiv des Abendmahls erläutert: »Tatsächlich bildet das Abendmahl auch eine der vielen durchgehenden Linien der Erzählung, indem es zu Beginn, in der Mitte und am Ende aufscheint«46. Osthövener macht sich die Zwei-Welten-Lehre Luthers zu eigen: »Kohlhaas ist nicht zuletzt darin ein Komplement zu Luther, dass er eine für die Religion charakteristische Unbedingtheit nun auch in rechtlicher Hinsicht vertritt und dass er eben darum scheitert, weil die Sphäre des Rechts derlei Unbedingtheiten nicht verträgt«47 und gewinnt daraus das Bild eines beschwichtigenden Luthers: »Ähnlich wie in der Begegnung mit Kleists Kohlhaas hat Luther seine Widersacher, die sich prophetische Kräfte zumaßen und himmlisches Licht in sich spürten, als satanische Kräfte gebrandmarkt. Ihm ging es tatsächlich um einen Endkampf des Göttlichen gegen das Satanische, und darin hat Kleists Stilisierung des Kohlhaas etwas Treffendes an das Licht gestellt, […].«48 – Gegenüber dieser polaren Gut/Böse-Dichotomie kommt meine Arbeit, eher auf Seiten Jochen Schmidts49 stehend, zu einer differenzierteren Einschätzung der Rolle Luthers in der Erzählung. Osthöveners emphatische Loyalität gegenüber Luther lässt ihn noch nicht einmal die Verlogenheit in der Diplomatie Luthers thematisieren, der z. B. gegenüber Kohlhaas den Vorwurf erhebt, er habe sich bloß leichtfertig (II, 45) um den Rechtsweg bemüht, zugleich aber weiß, dass es allgemein bekannt war, dass die im Kurfürstentum zweitmächtigsten Herren Hinz und Kunz von Tronka die Klage unterschlagen hatten (II, 49). Luthers – weihevoll mit theologisch imaginiertem Urteil vor dem Jüngsten Gericht – aufgestellte Behauptung, der Kurfürst wisse nichts von Kohlhaas’ Angelegenheit, (»Und muß ich dir sagen, Gottvergessener, daß deine Obrigkeit von deiner Sache nichts weiß – was sag ich? daß der Landesherr, gegen den du dich auflehnst, auch deinen Namen nicht kennt, dergestalt, daß wenn dereinst du vor Gottes Thron trittst, in der Meinung, ihn anzuklagen, er, heiteren Antlitzes, wird sprechen können: diesem Mann, Herr, tat ich kein Unrecht, denn sein Dasein ist meiner Seele fremd?« [II, 45]) beruht zumindest auf grob fahrlässiger Sachfremdheit, denn der Erzähler berichtet: »Der Kurfürst, durch einen Eilboten, von der Not, in welcher sich die Stadt Leipzig befand, benachrichtigt, erklärte, daß er bereits einen Heerhaufen von zweitausend Mann zusammenzöge, und sich selbst an dessen Spitze setzen würde, um den Kohlhaas zu fangen. Er erteilte dem Herrn Otto von Gorgas einen schweren Verweis, wegen der zweideutigen und unüberlegten List, die er angewendet, um des Mordbrenners aus der Gegend von Wittenberg loszuwerden; […]« (II, 43 f.), um dann zusammenzufassen: »Unter diesen Umständen übernahm der Doktor Martin Luther das Geschäft, […].« (II, 44) Sollte diese damals dort höchste theologisch-moralische Instanz von den Umständen, unter denen sie dieses Geschäft übernahm, so wenig gewusst, sich so einseitig informiert, und sich doch so seelsorgerisch weitreichend in ihr engagiert haben können, ohne dass dabei Zweifel an ihrer Integrität aufkommen müssen?50
Читать дальше