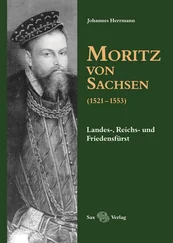Die gleichen braunen schulterlangen Locken, die gleiche zarte Gestalt, den schmalen Körperbau, der fast zerbrechlich wirkte. Der einzige Unterschied zwischen Mutter und Tochter waren die Augen. Katharinas Augen waren strahlend blau gewesen, während Olga unterschiedliche Augenfarben hatte. Eines war leuchtend blau und das andere strahlend grün. Olga seufzte, da hatte sich wohl der Herrgott nicht entscheiden können.
Jeder, der Olga und Katharina kannte, hatte stets betont wie ähnlich sich die beiden auch in ihrem Wesen waren. Die gleichen Interessen, der gleiche Starrsinn, um ein Ziel zu erreichen, die gleiche Verletzlichkeit. Beinahe so, als wären sie eine Person.
Olga öffnete die oberste Schublade der Kommode und holte eine große Schere heraus.
Sie grinste sich im Spiegel an. »Was brauchen wir Weiber einen Haubenhut! Wir schneiden uns einfach die Haare ab!« Sie hob einen dicken Haarschopf in die Höhe und schnitt ihn mit einem Ruck ab. Je schneller sie schnitt, desto besser wurde ihre Laune. Als keine Locke mehr bis zur Schulter reichte, legte sie die Schere zurück, lief in die Küche und kam mit einem Glas Nussschnaps zurück. Lachend prostete sie ihrem Spiegelbild zu und kippte den Schnaps in einem Zug hinunter.
Dann griff sie zur Lampe und beleuchtete die abgeschnittenen Locken, die auf dem Holzboden lagen.
»Tschort wosmi«, lachte sie und schloss die Tür der Kammer hinter sich.
Berta hatte bereits das Haus verlassen, als Olga am nächsten Morgen aufwachte. Einen Augenblick wusste Olga nicht, ob sie alles nur geträumt hatte, oder ob die Ereignisse des gestrigen Abends wirklich stimmten. Sie fasste sich auf den Kopf und merkte sofort, dass ihre Haare abgeschnitten waren. Es war kein Traum gewesen. Der Kopf tat ihr weh. Lag es an der Bloßstellung mit dem Haubenhut oder an dem Wein und Schnaps, den sie getrunken hatte? Olga entschied sich für das Erstere. Wie sollte man bei so verbohrten Budschakenweibern keine Kopfschmerzen bekommen? Aber sie wollte nicht mehr daran denken. Bald schon würde sie nach Sankt Petersburg gehen und ...
Olga stöhnte leise, als sie aufstand. Langsam ging sie in die Küche und kochte sich einen Tee. Sie füllte den Waschzuber mit kaltem Wasser aus den Eimern, die immer gefüllt neben dem Herd standen. Sie wusch sich mit dem eiskalten Wasser und steckte am Schluss noch ihren ganzen Kopf in den Zuber.
Abgetrocknet und wieder angezogen, trank sie ihren lauwarmen Tee und fühlte sich besser.
Olga stellte sich mit ihrer Teetasse in der Hand ans Fenster und schaute auf den Hof.
Ihr Blick wanderte vom Stall über die letzten Schneereste, die noch vereinzelt in den Ecken lagen. Alles wirkte friedlich und ruhig. In der Ferne bellte ein Hund.
Es war Ende Februar und immer noch sehr kalt. Bestimmt freuten sich die Menschen, wenn endlich der Frühling anbrechen würde. Hoffnungsvoll sahen alle dem Jahr entgegen und sehnten sich nach den Farben der ersten Blumen und dem Duft ihrer Blüten. Der Wunsch nach Frieden nach diesem langen Krieg war vergangenes Jahr im November endlich in Erfüllung gegangen. Wäre nicht der Tod der Mutter gewesen, könnte Olga auch allem mit mehr Freude entgegenblicken.
Katharina, die jede freie Minute an ihrer Nähmaschine verbracht hatte. Katharina, in einem neuen Kleid aus blauem Seidenstoff, so blau wie ihre Augen. Elegant hatte sie darin ausgesehen, zu fein für diese Umgebung. Als Kind war es Olga manchmal unangenehm gewesen, wenn die Mutter mit ihr an der Hand in solch einer Aufmachung in den Kaufladen ging oder durch den Ort lief. Trafen die Kleine böse Blicke mancher Bäuerinnen, schämte sie sich für die Mutter. Ebenso unangenehm war es ihr, bei erstaunten oder gar aufmunternden Blicken mancher Männer im Dorf.
Die Mutter schien das nicht zu bemerken, sie schritt erhobenen Hauptes durch Sarata. Als Olga Jahre später die gleiche Leidenschaft gegenüber Stoffen und raffiniert geschnittenen Kleidern erfasste, spazierte sie ebenso gleichgültig und stolz in eigen entworfenen Modellen durch den Ort. So wie Katharina die meiste Zeit an der Nähmaschine verbracht hatte, so tat es jetzt Olga. Entweder nähte sie, oder sie ging auf den Markt Stoffe aussuchen. Auch in der Tuchfabrik war sie eine gern gesehene Kundin, die zwar anspruchsvoll war, aber auch großzügig einkaufte, wenn sie etwas fand. Nur leider gab es wenige Monate nach Kriegsende hier noch keine Auswahl an Stoffen. Hoffentlich würde sich das bald ändern.
Olga stellte ihre Teetasse ab und schaute auf die Uhr. Sie war zwar heute sehr spät aufgestanden, doch wenn es nach ihr gegangen wäre, könnte es bereits Mittag sein. Wie langsam aber auch die Zeit heute Vormittag verging, dachte sie und lauschte eine Weile dem Ticken der alten Wanduhr.
Man hatte ihr gesagt, im Laufe des Vormittags würde die Lieferung eintreffen. Vor Mittag brauchte sie nicht zu kommen. Die vergangenen drei Vormittage verbrachte Olga bereits mit Warten. Jedes Mal wurde sie enttäuscht, als sie ihre Bestellung abholen wollte und diese nicht eingetroffen war. Von Deutschland bis ans Schwarze Meer nach Bessarabien war es eben doch ein langer Weg.
Olga hörte Geräusche von außen. Jemand rannte über den Hof. Es war Berta die ins Haus stürmte.
»Sie haben mich genommen!«, rief Berta ihrer Schwester entgegen. Ihr Gesicht strahlte vor Freude und ihre Augen funkelten. Dann starrte sie entsetzt zu Olga: »Wie siehst du denn aus?«
Olga zuckte mit den Schultern.
»Na ja, ich meine nur«, Berta fasste an Olgas Haare. »Da fehlt ein ...«
»Du hast es also geschafft, gratuliere«, unterbrach Olga.
»Ich bin noch ganz aufgeregt. Es hat sich verdient gemacht, dass ich während dem Krieg im Lazarett geholfen habe.«
»Hoffentlich. Schließlich hast du dich für die vielen Verletzten bis zur Erschöpfung aufgeopfert. Es hat ja nicht mehr viel gefehlt und wir hätten dich pflegen müssen.«
»Olga, endlich!« Berta umarmte die Schwester stürmisch. »Endlich darf ich die Ausbildung zur Krankenschwester machen.«
»Du weißt auch hoffentlich, was das heißt: zwei Jahre Schülerin, zwei ...«
»Zwei Jahre Probeschwester«, unterbrach Berta. »Und danach Hilfsschwester. Wenn ich 25 bin, werden sie mich als Schwester einsegnen.« Zufrieden schaute Berta auf Olga.
»Ach Berta, ich freu mich für dich. Aber du wirst jetzt dein Leben lang in einem dunkelgrauen Kleid mit einer hellgrauen Schürze darüber rumlaufen. Dazu den braven weißen Kragen am Hals und das schlimmste: diese weiße Haube. Überleg dir das gut. Tag für Tag grau und weiß.«
»Du hast vielleicht Sorgen«, lachte Berta. »Wenn das so schlimm ist, dann frag ich mich, warum sich am Sarataer Diakonissenhaus so viel mehr Schülerinnen melden, als aufgenommen werden können.«
Olga zuckte nur mit den Schultern. Sie verstand das nicht. Krankenschwester werden konnte sie sich nie und nimmer vorstellen.
»Olga, jetzt sag schon, was hast du mit deinen Haaren gemacht?«
»Solltest du auch tun, das ist viel praktischer. Vor allem für dich, du trägst ja bald Zeit deines Lebens eine Haube.«
»Spotte nur«, meinte Berta beleidigt.
»Ach komm«, fiel ihr Olga ins Wort und umarmte die Schwester. »Es war nicht richtig von mir, das zu sagen. Hilfst du mir heute Abend, die Haare gleichmäßig abzuschneiden? Ist mir nicht so gut gelungen.«
Berta nickte. »Ich muss gleich mal zu Lydia rüber und ihr die Neuigkeit sagen.«
Bevor Olga noch etwas sagen konnte, schlug Berta bereits die Türe hinter sich zu.
Wieder schaute Olga auf die Uhr. Sie würde jetzt die Zeit nutzen und die Küche aufräumen und putzen. Damit konnte sie Berta eine große Freude machen. Berta war nämlich diejenige, die sich hauptsächlich darum kümmerte, dass Haus und Hof saubergehalten wurden und jeden Tag ein warmes Essen auf dem Tisch stand. Olga wusste gar nicht, wie es werden sollte, wenn Berta als Schwesternschülerin anfing. Dann war sie selbst wohl oder übel auch mal dran mit der Hausarbeit.
Читать дальше