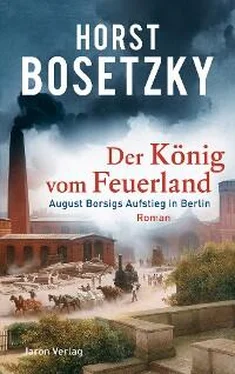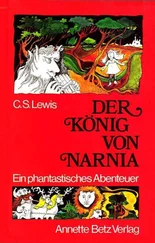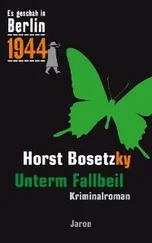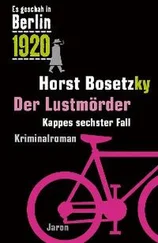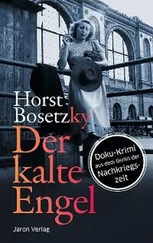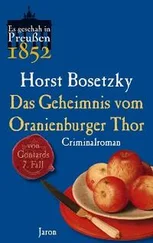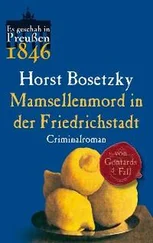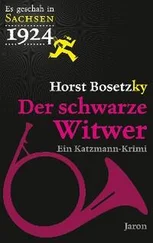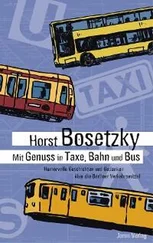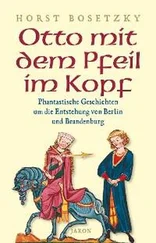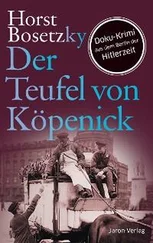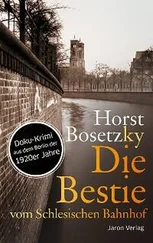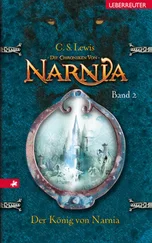Borsig war erstaunt über diese Frage. »Nein. Ich dachte, die sind jetzt verboten.«
»Das sind Sie auch, und es gibt einige Jahre Festungshaft, wenn einer getötet wird, aber beim Adel und in der Armee drückt man schon mal beide Augen zu, wenn sich zwei Zu und Von duellieren. Die Ehre ist eben das Wichtigste.« Järschersky begann nun zu flüstern. »Ich weiß, dass es morgen früh um fünf im Thiergarten ein Duell geben wird. Waldemar von Schwanow ist von einem Neffen zum Zweikampf gefordert worden, dem Leutnant Ferdinand von Deichmann. Schwanow hat gesagt: ›Ich bin ein Mann, der auf dem Schlachtfeld Pulver gerochen hat – du aber nur im Bett das Puder deiner Mätressen.‹«
Borsig staunte. »Woher kennst du die denn alle?«
»Der von Schwanow hat ausgedehnte Waldungen und sein Holz immer an meinen Vater verkauft. Da sind wir oft bei ihm gewesen.«
Borsig schauerte es ein wenig. »Und die schießen richtig mit Pistolen aufeinander?«
»Ja, meinst du denn, die bewerfen sich mit Pferdeäppeln?«
Am nächsten Morgen, kaum hatte es von den Kirchtürmen vier Uhr geschlagen, liefen sie zum Thiergarten, um sich in der Nähe des Brandenburger Thores im Gebüsch zu verstecken – vor sich die Lichtung, auf der das Duell stattfinden sollte. Järscherskys Informationen waren richtig gewesen: Pünktlich erschienen die beiden Duellanten mit ihren Sekundanten. Wie schwarze Krähen kamen sie vom Hauptweg her. Einer der Begleiter trug einen Mahagoni-Koffer mit den Waffen. Es wurden einige Worte gewechselt, die Järschersky und Borsig in ihrem Versteck aber nicht verstanden. Die Distanz, über die der Schusswechsel gehen sollte, wurde vermessen. Dies geschah dergestalt, dass die beiden Sekundanten Rücken an Rücken standen und sich dann jeweils fünfzehn Schritte voneinander wegbewegten. Als die Standpunkte der beiden Schützen mit zwei armdicken Ästen markiert waren, wurde aber noch gewartet.
»Der Arzt ist noch nicht da«, flüsterte Järschersky.
Der erschien schließlich, und von Schwanow, der Ältere der beiden, und der Leutnant traten, ohne sich eines Blickes zu würdigen, an den aufgeklappten Mahagoni-Koffer, griffen zu den absolut gleichen Pistolen und schritten wie mechanische Puppen zu ihren festgelegten Positionen. Dabei wurden sie immer langsamer, als sei die Feder, mit der man sie aufgezogen hatte, abgelaufen. Borsig kam es so vor, als würden sie gar nicht ankommen wollen. Doch nichts ließ sie mehr aufhalten, und als sie ihre Markierungen erreicht hatten, machten sie wie auf Befehl gleichzeitig kehrt, so dass nun ihre Gesichter einander zugewandt waren. Der Lauf ihrer Waffe zeigte noch nach unten.
In der Mitte zwischen beiden, aber in sicherer Entfernung von der Schusslinie, stand der eine Sekundant mit einem weißen Tuch in der hochgereckten rechten Hand.
Järschersky zitterte vor Erregung. »Du oder ich! Sein oder Nichtsein!«
August Borsig schloss die Augen und dachte nur: Du sollst nicht töten! Am liebsten wäre er auf die Lichtung gestürzt, um die beiden Adligen an ihrem Tun zu hindern. Järschersky musste das gespürt haben, denn er drückte ihn fest auf den Boden.
Dann wurde das Tuch gesenkt, und der Neffe als Beleidigter hatte den ersten Schuss. Seine Kugel verfehlte die Brust von Schwanows.
Der aber traf.
Borsig sprang auf und lief in Richtung Straße. Järschersky folgte ihm. Als sie wieder in der Münzstraße waren und frühstücken wollten, kam ihnen die Witwe Järschersky schon im Hausflur entgegen, völlig aufgelöst.
»Bei uns is eingebrochen worden!«, rief sie ihnen zu.
Järschersky sah Borsig vorwurfsvoll an. »Das kommt davon, wenn man Berlin langweilig findet!«
Bei Borsig hatten sie nur ein paar Münzen mitgehen lassen, so dass ihn dieser Zwischenfall nicht besonders aufregte. Wilhelm Järschersky hingegen fehlte einiges an Geld, Gebrauchsgegenständen und Kleidungsstücken. Dieser Verlust führte dazu, dass er den ganzen Tag über schlechte Laune hatte und am Abend unbedingt um die Häuser ziehen wollte, um bei Bier und Schnaps sein Elend zu vergessen. Borsig schloss sich ihm ohne Zögern an, denn auch er fühlte sich schlecht. Sein Heimweh führte dazu, dass er Schlesisch sprach.
Wenns dann wird zum Saufa kumma, Do warn irscht die Bäuche brumma! Wein, dann warn ber wie Wosser scheppa, Saufa aus dan guldna Teppa. ’s Duppelbier werd niemals sauer, Denn dirt sein de besta Brauer.
Es ging feuchtfröhlich zu, und gegen Mitternacht hatte Borsig alle Weinkeller und Kneipen kennengelernt. Plötzlich war Järschersky verschwunden. Panik erfasste Borsig, denn es war stockfinster – wie sollte er nun in der fremden Stadt allein nach Hause finden? Eine Straßenbeleuchtung gab es nicht, nur an wenigen Häusern hingen Laternen. Das Pflaster war grob, und in den Rinnsteinen flossen die Fäkalien Richtung Spree. Um in die Häuser zu gelangen, musste man über ausgelegte Bretter laufen. Er stürzte, rappelte sich wieder auf, taumelte erneut und schaffte es, ein paar Schritte zu gehen, indem er sich an einer Hauswand festhielt. Zum ersten Mal in seinem Leben war er richtig betrunken. »Der Borsig, der Borsig«, grölte er, »der hat das ganze Leben noch vor sich.« Dann schlug er lang hin. Das Letzte, was er wahrnahm, war die Singuhr der Parochialkirche mit ihren 37 Glocken.
Als er wieder zu sich kam, lag er auf einer langen hölzernen Bank. Im ersten Augenblick dachte er, er würde sich in Beuths neuer Gewerbeschule befinden. Doch da wurde ein Betrunkener in den Raum geführt, der schrie, man möge ihn freilassen, da er sonst seinen Dienst verlieren würde. Ein Junge fiel im Schlaf auf die Erde und schrie fürchterlich. Ein elegant gekleideter junger Mann hielt seinen Pass in die Höhe und erklärte in gebrochenem Deutsch, er sei Engländer und niemand dürfe einen Untertanen Seiner Majestät festhalten.
»Na, nu jehm Se endlich Ruhe, Sie! Die andern wolln ooch schlafen.« In der Tür stand ein Aufseher, ein altgedienter Soldat, und rauchte ruhig seine Pfeife.
»Wo bin ich hier?«, fragte Borsig.
»In der Stadtvogtei, mein Guter.«
Am nächsten Morgen flog die Tür auf, und ein Constabler kam, um Borsig zum Verhör zu holen. Der erzählte seine Geschichte, und man entließ ihn mit der Warnung, Herrn Beuth, dem Staatsrath und Director der Technischen Deputation für Handel und Gewerbe, von seinem wüsten Treiben Mitteilung zu machen, wenn er noch einmal aufgegriffen und zum Molkenmarkt No. 2 gebracht würde.
Beuths Technische Schule war im Hause Klosterstraße 36 untergebracht, einem alten zweistöckigen Bau mit einer monotonen Fassade, und bestand im Grunde genommen nur aus zwei nicht eben großen Klassenräumen. Beuths Ziel war nicht eine Anstalt, in der die Massen ausgebildet wurden, sondern er setzte auf Qualität und wollte nur die Besten hier versammelt sehen. So hatte er dieses neue Lehrinstitut vor zwei Jahren mit nur dreizehn Schülern und vier Lehrern eröffnet und bestimmt, dass nie mehr als dreißig Schüler zugleich unterrichtet werden sollten.
Wer Beuth zum ersten Mal sah, hätte ihn für einen Dichter oder Komponisten halten können, beim Formulieren des Konzeptes aber hatte der Offizier in ihm Oberhand gewonnen, und so las sich die Präambel über Wesen und Aufgabe seines Institutes wie ein Befehl an seine Schwadron:
Der Unterricht wird kostenfrei erteilt. Die Disziplin ist streng. Nachlässige Schüler und solche, die dem Unterricht nicht folgen können, werden in den ersten Monaten entlassen, damit sie die Lehrer nicht ermüden und andern kein schlechtes Beispiel geben. Über denselben wissenschaftlichen Gegenstand wird in zwei aufeinanderfolgenden Stunden gelehrt. In der einen werden die Schüler über das in der vorigen Stunde Gelernte geprüft. In der anderen wird mit dem Unterricht fortgefahren. Geübte Schüler sollen Vorschüler (Repetitoren unter Aufsicht des Lehrers) sein.
Читать дальше