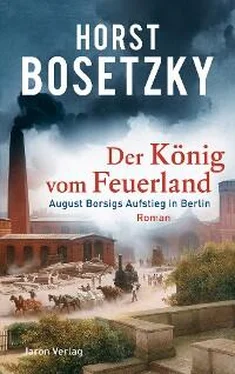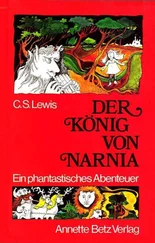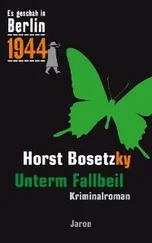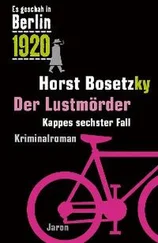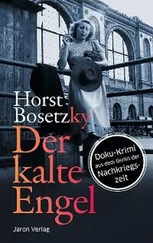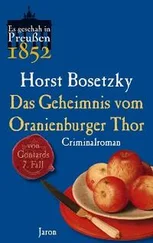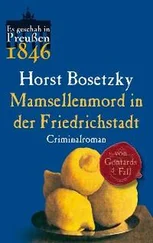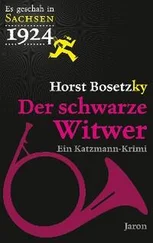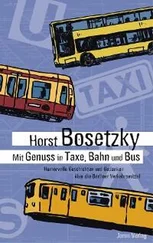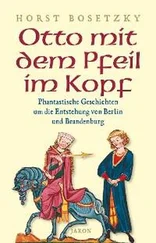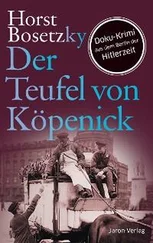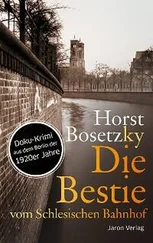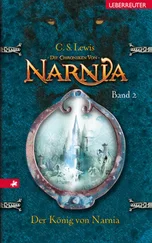Die Witwe Järschersky hieß August Borsig herzlich willkommen. »Ach du meine Jüte, drei Bonbons in eene Tüte! Sie sind nun schon der dritte Jast aus Breslau, den ick hier bemuttan darf. Erst war et der Friedrich von Gentz, aber der ist ja ab in det jlückliche Österreich, und denn der Herr Schleiermacher, aber wat der so rumspinnt, det is mir allet höchst schleierhaft.« Dann verwies sie auf ihre Nähe zu Madame Du Titre und hatte auch gleich noch eine Anekdote bereit, die man sich von ihrer Freundin erzählte: »Sie hat Joethe schon imma bewundert, und als er vor ’n paar Jahre in Berlin war, hat er ooch von ihr jehört. Als er ihr uff de Straße sieht, da will er ihr verwirren und fragt: ›Kennen Sie mich?‹ Da macht sie janz ehrfürchtich ’n Knicks und ruft: ›Jroßer Mann, wer sollte Ihnen nich kennen: Fest gemauert in der Erden/steht die Form, aus Lehm gebrannt !‹«
Borsig ging es wie ein Mühlrad im Kopf herum, und er zog sich erst einmal in sein Zimmer zurück, um wieder etwas zu sich zu kommen. Erschöpft warf er sich auf das Bett. Seine Gefühle waren höchst zwiespältig. Einerseits fühlte er sich einsam und verlassen und sehnte sich nach seiner Familie, nach Marie, nach Kiesewetters Zimmerei, andererseits aber war er froh und glücklich, ein neues Leben zu beginnen, war er neugierig auf die Preußenresidenz. Er fühlte sich wie ein Schauspieler, der auf der Breslauer Bühne zehn Jahre lang einen Zimmermann gespielt hatte und sich nun freuen konnte, dass es in Berlin andere Rollen für ihn gab.
Er mochte eine Stunde tief und fest geschlafen haben, als jemand an seine Zimmertür klopfte. Es war Wilhelm Järschersky, der Sohn seiner Wirtin, und der wollte ihn fragen, ob er morgen mit ihm durch Berlin spazieren und den Cicerone spielen dürfe.
»Gerne. Aber haben Sie denn die nötige Zeit dafür?«
Wilhelm Järschersky lachte. »Aber ja, ich bin Student, und bei uns hat das neue Semester noch nicht so richtig angefangen – jedenfalls nicht für mich.«
Erst als der Studiosus wieder gegangen war, bemerkte Borsig die Zeichnung, die über seinem Bett hing. Sie zeigte einen jungen Mann, der am Brandenburger Thor aus der Postkutsche stieg und frohgemut Berliner Boden betrat. Darunter stand: Schicksal, ick erwarte dir!
Egells bedauerte zu keiner Zeit, dass er sich vor zwei Jahren mit staatlicher Unterstützung selbständig gemacht hatte. Gemessen an dem, was er in England gesehen hatte, war seine Maschinenanstalt nur eine kleine Klitsche und mehr Manufactur als Fabrik. In der Lindenstraße betrieb er eine kleine Eisengießerei und in der Mühlenstraße, der späteren Obentrautstraße, eine Schlosserwerkstatt. Viel warf das alles noch nicht ab, und immer wieder ging ihm ein Ausspruch seiner Mutter durch den Kopf: »Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.« Er baute alles, was irgendwie denkbar war, und erwarb sich schnell einen guten Ruf als Konstrukteur. Besonderen Erfolg hatte er mit einer gedrungenen und raumsparenden Dampfmaschine, einer sogenannten Bügelmaschine.
Einer seiner besten Leute war Johann Friedrich Ludwig Wöhlert, ein Tischler aus Kiel, der 1818 nach kurzer Wanderschaft nach Berlin gekommen war. Er sah heute Morgen etwas müde aus.
»Na, Wöhlert, gestern wieder zu lange auf den Spuren Ihres Vaters gewandelt?« Der war Brauer.
»Nein, ich habe nur mit geschlossenen Augen nachgedacht. Fragt mich gestern ein Constabler, mit dem ich ins Gespräch gekommen war, ob unsere Bügelmaschine nicht was für seine Frau wäre. ›Wir haben acht Kinder und so viel Wäsche!‹ Da frage ich mich, ob man nicht wirklich etwas bauen kann, das mit heißem Dampf die zerknitterten Wäschestücke glättet …«
»Hm …« Egells dachte nach. »Möglich erscheint mir das schon, aber die Leute müssten dafür statt ihrer Küche kleine Säle zu Hause haben.«
Auch Egells, ansonsten ein rastloser Arbeiter, war heute etwas müde. Schließlich war er jungverheiratet, und seine Anna Elisabeth Sabina, Tochter des Porzellanmalers Peter Angelé, hatte ihm vermittelt, dass ein Bett auch anderem als der bloßen Nachtruhe dienen konnte.
Gegen Mittag ließ sich Beuth in der Lindenstraße sehen. Egells hieß seinen Freund und Förderer herzlich willkommen.
»Na, willst du sehen, ob sich die Gelder, die Preußen hier investiert hat, auch verzinsen werden?«
Beuth lächelte. »Alles, was wir jetzt für die Industrialisierung unseres Landes tun, wird sich später einmal auszahlen. Nein, ich komme, um zu hören, wie es mit dem Umzug in die Chausseestraße vorangeht.«
»Wir werden erst nächstes Jahr alles unter Dach und Fach haben, aber wir kommen mit allem gut voran.«
»Das freut mich zu hören«, sagte Beuth. »Die Königliche Eisengießerei ist ja schon seit nahezu zwanzig Jahren dort zu Hause, und ich hoffe, dass sich in der Gegend nordöstlich des Oranienburger Thores – Chausseestraße, Zollmauer, Garten- und Liesenstraße – bald viele Eisengießereien und Maschinenbau-Anstalten ansiedeln werden. Aus Dutzenden von Schornsteinen sehe ich Rauch in den Himmel steigen.«
Bis der Unterricht in Beuths Institut begann, hatte August Borsig noch zwei Wochen Zeit, sich mit Preußens Residenz vertraut zu machen, und einige Male zog er auch mit Wilhelm Järschersky durch Berlin, das gerade einen wunderbaren Altweibersommer erlebte. Die Damen, die nachmittags Unter den Linden spazieren gingen, hatten zum Teil noch ihre bunten Sonnenschirme aufgespannt, und der Thiergarten zeigte weiterhin ein sattes Grün. Die wenigen Blätter, die von den Linden und Kastanien zu Boden schwebten, fielen nicht weiter ins Gewicht.
Zuerst ging es zum Schloss der Hohenzollern, und Järschersky geriet so ins Schwärmen, dass es Borsig fast zu viel wurde. Denn so recht imponieren wollte ihm das Gebäude nicht, schließlich war auch das Breslauer Schloss keine Hundehütte. Er hörte erst wieder richtig zu, als Järschersky vom Grünen Hut zu erzählen begann.
»Dieser kleine Turm, den du dort oben siehst, ist der Grüne Hut. Er ist ein Überbleibsel der alten Burg, die hier gestanden hat, und diente bis 1648 als Gefängnis. Ganz unten im Turm stand die Eiserne Jungfrau, eine Frauengestalt aus Eisen. Die weitgeöffneten Arme waren als Schwerter ausgebildet, und im Leib befanden sich links und rechts scharfe Messer. Wurde einer zum Tode verurteilt, musste der vor der Eisernen Jungfrau auf eine steinerne Platte treten und sie küssen. Dadurch wurde ein Mechanismus ausgelöst, und die Arme umfingen ihn, pressten ihn gegen die Messer und zerschnitten seinen Körper. Die einzelnen Stücke der Leiche fielen dann durch eine Klappe runter in die Spree – und die Fische und die Krebse hatten was zu fressen.«
Borsig schüttelte sich und war in den kommenden Wochen nur schwer dazu zu bewegen, Fische aus der Spree zu essen. Weniger gruselte ihm vor der Weißen Frau, dem Schlossgespenst der Hohenzollern, bei dem es sich um Anna Sydow handeln sollte, eine Gespielin des Kurfürsten Joachim II. Kaum war der verstorben, beraubte sein Sohn die »schöne Gießerin« all ihrer Güter und Kleinodien und ließ sie auf die Festung Spandau bringen, wo sie nach harter Behandlung verstarb. Sie kam aber im Grab nicht zur Ruhe und wurde zur Todesbotin der Hohenzollern. Jedes Mal, wenn sich ein Landesherr anschickte, einzugehen in die Ewigkeit, erschien sie im Berliner Schloss.
»Da bin ich ja mal gespannt«, sagte Borsig, dessen Liebe zum König sich in Grenzen hielt, hatte sich doch Friedrich Wilhelm III. seiner Meinung nach im Kampf gegen Napoleon am Anfang recht dämlich angestellt.
»Weiter zum Opernhaus«, sagte Järschersky, »mit dessen Bau 1741 begonnen worden ist. Die Pläne stammen von Knobelsdorff, aber Friedrich der Große soll da auch ein Wörtchen mitgeredet haben. 1742 gab es die erste Opernaufführung, später auch Maskenbälle.«
»Ah ja …« Borsig erinnerte sich an Breslau, wo der Geheime Rath Ludger von Krauthausen als Nero gegangen war.
Читать дальше