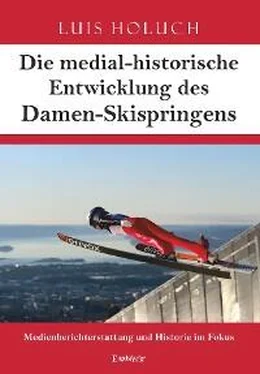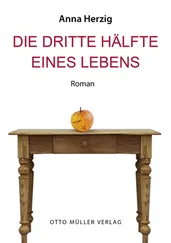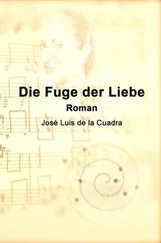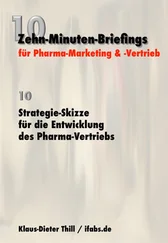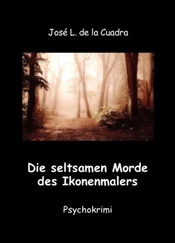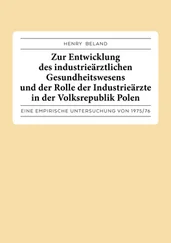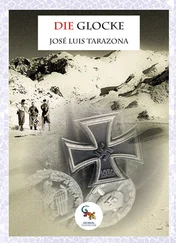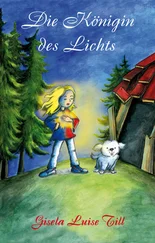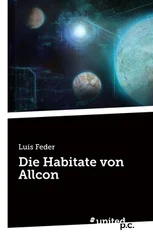Die Anlauflänge und -neigung variiert von Schanze zu Schanze. Je nach Größe der Schanze resultieren daraus unterschiedlich hohe durchschnittliche Anlaufgeschwindigkeiten. Eine vermeintlich logische Regel gilt jedoch nicht: der Anlauf einer Skiflugschanze (ab HS 185) ist nicht zwingend länger als der einer Großschanze.
Der Anlauf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen (HS 140) ist beispielsweise länger als der der Kulm-Skiflugschanze in Bad Mitterndorf (HS 225). 3
Was alle Schanzen jedoch gemeinsam haben, ist der Schanzentisch, an welchem die zweite Phase eingeleitet wird. Beim Absprung versucht der Athlet die Schanzentischkante mit den Füßen exakt zu erwischen, um dort maximale Kraft anbringen zu können.
„Der Absprung ist die wichtigste, aber zugleich auch schwierigste Phase beim Skispringen. Du bist jetzt über 90 Kilometer pro Stunde schnell, manchmal noch schneller. Für die eigentliche Absprungbewegung bleibt allerdings nur ein winziges Zeitfenster von gerade einmal 0,3 Sekunden. Das ist ungefähr die Zeitspanne, in der du „Ooohhh“ oder „Mist“ sagen kannst.
In einem [fünf] Meter engen Korridor auf dem Schanzentisch entscheidet sich, ob der Sprung gelingt – oder nicht. Ein optimales Timing ist also alles entscheidend.“ 4Aus seiner persönlichen Sicht spielen sich die fünf Phasen (die Hannawald jedoch etwas anders benennt) folgendermaßen ab:
„1. Die Vorbereitung: In spätestens 20 Sekunden muss ich vom Absprungbalken losfahren. Ich greife noch mal zum Schuh, um zu kontrollieren, ob alles fixiert ist. Noch ein letzter Blick auf die Bindung vorn – und ab geht’s.
2. Die Anfahrt: Wenn ich mich vom Balken abstoße, gleicht mein innerer Computer noch mal alle wichtigen Details vom Ablauf des Sprungs ab. Anfahrtshockenhöhe, Schwerpunkt, Armhaltung, Kopfhaltung. Nach 3 bis 4 Sekunden visiere ich den Schanzentisch an.
3. Der Absprung: Meine Augen haben mit den Jahren gelernt, die aktuelle Anfahrtsgeschwindigkeit und den Weg, den ich für meine Absprungbewegung brauche, so zu berechnen, dass ich weiß, wann der richtige Moment des Absprungs da ist.
4. Der Flug: Nach dem Absprung fühle ich bis ins Kleinste nach, wie der Ski mir „entgegenkommt“. Der Drehimpuls, der nach dem Absprung aus den Beinen kommt, lässt dich „auf den Ski legen“. Du ahnst schon, ob es weit geht – oder nicht.
5. Die Landung: Ich hatte (hoffentlich) reichliche Sekunden Zeit, den Flug zu genießen. Jetzt gilt es: volle Konzentration auf die Telemark-Landung. Linker Fuß vor und beim Aufsetzen Gleichgewicht halten.“ 5
Mittels Bildmaterial wird nun zunächst der Absprungvorgang illustriert und erläutert. Zur Vereinfachung der Darstellung wurde hier eine Aufnahme eines Absprungs der Slowenischen Springerin Špela Rogelj verwendet und die einzelnen Phasen anschließend mittels Screenshots festgehalten.

Abbildung 2a) und b): Die Slowenin Špela Rogelj bei der Absprungbewegung während des Sommer Grand-Prix‘ 2015 in Courchevel (Frankreich) (© Ursprüngliches Videomaterial: Stane Baloh / Bearbeitung vom Autor).
In Bild 2a) sitzt die Slowenin in in ihrer Anfahrtshocke, welche sie in Bild 2b) langsam auflöst. Sie bereitet den Absprung vor, in dem sie Gesäß und Oberkörper beginnt aufzurichten und die Arme von ihrem Körper löst.

Abbildung 2c) und d): Die Slowenin Špela Rogelj bei der Absprungbewegung während des Sommer Grand-Prix‘ 2015 in Courchevel (Frankreich) (© Ursprüngliches Videomaterial: Stane Baloh / Bearbeitung vom Autor).
Rogelj hebt den Oberkörper parallel zur Hocke der Beine an. Langsam löst sich bei ihr der 90-Grad-Winkel der Schenkel auf. Sie versucht so, die Kniespitze auf Höhe der Schanzentischkante zu bringen. Ihr Körper formt in Abbildung 2d) eine Art Sigma. Die Arme werden nach hinten abgespreizt, damit diese den kurzmöglichsten Weg neben den Körper finden. Die Armhaltung ist während des Absprungs und dann auch während der Flughaltung von Bedeutung. Ein Rudern beim Absprung sollte tunlichst vermieden werden, ebenso wie in der Luft.

Abbildung 2e): Die Slowenin Špela Rogelj bei der Absprungbewegung während des Sommer Grand-Prix‘ 2015 in Courchevel (Frankreich).
Die Skispitzen haben die Schanzentischkante nun bereits passiert. Rogelj bewegt das Gesäß nach vorne, ebenso wie die Oberschenkel. Diese sollen beim Absprung die Unterschenkel überholen und den größten Kraftimpuls beim Absprung leisten. Der Kopf wird nach vorne in den Wind gestreckt, er gibt die Richtung des Absprungs und den Absprungwinkel vor.
Der Athlet steht beim Absprung gewissermaßen aus der Hocke auf, um in den Flug zu gelangen. Dabei ist es ratsam, den Oberkörper und den Ski möglichst flach und plan nach oben und vorne laufen zu lassen, um so geringstmöglichen Luftwiderstand zu bieten. Denn dieser kostet Geschwindigkeit und schlussendlich auch Weite.
„Alles ist perfekt, wenn es beim Absprung gelingt, eine möglichst große vertikale Absprunggeschwindigkeit mitzunehmen und den Körperschwerpunkt [KSP] und damit auch die folgende translatorische Flugbahn anzuheben, sowie einen möglichst großen, senkrecht zum Schanzentisch orientierten Kraftstoß zu erzielen.“ 6Translation bezeichnet in der Physik indes eine „geradlinig fortschreitende Bewegung eines Körpers, bei der alle seine Punkte parallele Bahnen in gleicher Richtung durchlaufen“ 7.
„Dies erreichen die Springer durch eine explosive Streckung der Sprung-, Knie- und Hüftgelenke. Zugleich wird der Oberkörper nach vorne geschoben, um den KSP zu verlagern und das erforderliche Drehmoment vorwärts, bzw. auch den vorwärts gerichteten Drehimpuls erzeugen zu können (Schwameder 2008). Dies ermöglicht wiederum eine schnelle Einnahme der aerodynamisch günstigen Flughaltung der Flugphase. Generell kann man annehmen, dass ein höherer Drehimpuls eine schnellere Einnahme der optimalen Flughaltung begünstigt. 8“
Hannawald bezieht sich in seinen Ausführungen auf die Studienarbeit „Biomechanik – Skispringen“ der Studentin Isabelle Glauner von der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg.
Glauner beschreibt in dieser Studienarbeit den Ablauf eines Skisprungs aus wissenschaftlicher (physikalischer) Sicht und erhielt dafür die Note 1,0 9.
Oder, wie Hannawald schreibt: „Sie erklärt wissenschaftlich, was wir Springer von den Trainern in jeder Trainingseinheit mit einfachen Worten auf den Weg bekommen und intuitiv längst wissen. 10
Doch was ist die Folge, wenn der Athlet dieses optimale Timing nicht hat und deshalb zu früh oder zu spät – mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht – abspringt? Auch diese Frage beantwortet Hannawald mit seinem Erfahrungsschatz aus zwölf Jahren Weltcup-Erfahrung 11:
„Wenn du zu spät abspringst, ist das eine kleine Katastrophe, denn deine Kraft beim Absprung stößt ins Leere und der nach unten gerichtete Kraftstoß kann keine Gegenkraft erzeugen. Deine Flugkurve fällt flacher aus. Wenn du aber zu früh abspringst, ist das noch schlimmer. Der Ski bekommt im ersten Moment keine Anströmung. Du musst kurz warten, bis der Ski trägt. Dieser winzige Moment kann dich zig Meter kosten. Weltklasse oder Bruchlandung? Dies entscheidet sich am Schanzentisch. Wenn du deine Skier zu steil in den Wind stellst, raubt der größere Luftwiderstand zunehmend Weite. Wenn du die Skier zu flach in den Wind stellst, werden die „Tragflügel“, die der Körper und die Skier im Idealfall bilden, zerstört. Auch das kostet Meter.“ 12
Читать дальше