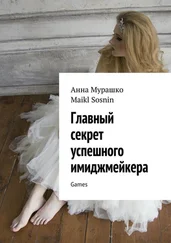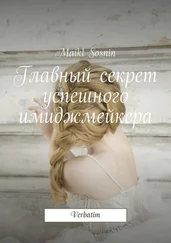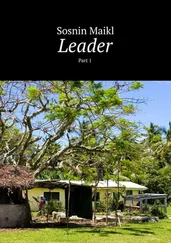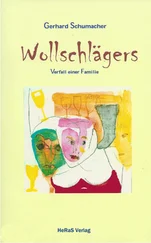An jedem Monatsanfang, immer ganz pünktlich, war die abgemachte Summe angekommen. Taschengeld für mich, Unterhaltsgeld für Tante Elvira. Ich konnte mir vorstellen, wie schwer es für Mutter gewesen sein musste, für mich über so viele Jahre regelmäßig Geld nach Berlin zu schicken. Doch jetzt ging es mir finanziell richtig gut! Ich hatte keine Sorgen, war mit meinem Leben mehr als zufrieden. Bis auf einmal, von einem Tag auf den anderen, fast von einer Stunde auf die nächste. Nach über vierzig Jahren fing es wieder an. Das tiefe Fallen ins Dunkle, Bodenlose, wo es kein Auffangen gibt.
Im Nachhinein zermarterte ich mir immer wieder den Kopf. Was war der Auslöser gewesen? Was hatte in meinem Kopf, in meinen Gedanken mit einem Klick alles verändert? Was war das, was von mir nicht zu steuern war? Ich war doch ein absoluter Verstandesmensch geworden. Hatte gelernt, was mir guttat oder was ich meiden musste. Nach vier Jahrzehnten! Wo doch alles abgehakt schien. Es war einfach wieder da, aus dem Nichts.
Alle Untersuchungen brachten kein Ergebnis. Der Neurologe bestätigte mir: „Eigentlich alles in Ordnung!“ Es gab nichts, was ein klares Krankheitsbild ergeben hätte. Keine Schilddrüsenerkrankung. Nicht der Kreislauf, der zwar hin und wieder verrücktspielte, aber nicht der Grund sein konnte. Auch die Schlaflosigkeit mit den anstrengenden Albträumen war mit Berufsstress alleine eigentlich nicht zu erklären. „Es ist das Vegetativum. Das ist nicht zu steuern. Mit dem eisernsten Willen nicht! Es ist was in Ihnen, das will heraus! Ihr Körper will es loswerden. Es ist in Ihnen gewachsen, eine Geschwulst aus einer Last, die Sie mit sich herumschleppen. Was es ist, müssen Sie herausfinden!“ Das war die vorläufig letzte Diagnose. „Gehen Sie zu einem Therapeuten, der kann Ihnen helfen“, empfahl mir daher der Hausarzt, der mich und Tante Elvira seit Jahren betreute.
Doktor Winkler, ein erfahrener, älterer Psychiater, fand dann auch schnell heraus, an was meine Seele litt. Er überzeugte mich davon, dass sich die Ängste meiner Kindheit, die Trennung von zuhause, das Drama um meine Freundin Sonja und der noch immer unaufgeklärte Mord an ihr wieder gemeldet hatten. An mir nagte die Frage: „Hat sich denn niemand richtig um letzte Aufklärung bemüht?“ Ich merkte sehr bald, dass es vor allem diese Frage war, die mit einer neuen, nie gekannten Wucht über mich hereingebrochen war. „Warum hat mich damals eigentlich keiner richtig befragt? Ich hätte doch was gewusst!“ Es hatte nur einige oberflächliche Fragen der Polizei an mich gegeben: „Kannst du was von dem Tag erzählen?“ Und gleich nachgeschoben: „Sicher net! Du warst ja in der Zeit in der Schule im Dorf unten.“ Aber ich hätte doch was gewusst! Von den Tagen vor der Tat hätte ich erzählen können.
Er nahm sich viel Zeit für mich, der Doktor Winkler, als ich ihn in seiner Praxis besuchte: „Heilung gibt es nur, wenn Sie sich den Geschehnissen endlich stellen! Zudecken hilft nicht! Das Unrecht schreit laut und anklagend bei jeder passenden, vor allem aber unpassenden Gelegenheit unter dem Teppich hervor. Dadurch gibt es auch kein Vergessen! Ein Verbrechen fordert Sühne. Das Opfer verlangt danach. Nur dann ist Ruhe. Für alle!“ Mit ernsten, eindringlichen Worten sprach der Arzt zu mir. Seine Brillengläser blitzten mich bei jeder Bewegung an wie Spiegel. Ich hatte den Eindruck, als leuchte der Doktor mein Innerstes aus und könne in aller Klarheit sehen, was mir fehlte.
„Ich weiß, dass er Recht hat“, war mir sofort klar. „Er hat die richtige Stelle bei mir getroffen. Ich merke jetzt schon: Das ist die beschädigte Saite. Sie muss ausgewechselt werden, damit das Instrument wieder klingen kann! Ich will heim. Will den Ballast loswerden, egal, was auf mich zukommt.“
Ich schließe die Augen, lehne mich in die Polster zurück. Sofort sind unvergessene Bilder da. Ich sehe mich zuhause in der Küche sitzen, wo ich der Mutter bei der Arbeit zuschaue. Heimelig und geschützt fühle ich mich hier bei ihr, keine Ängste haben Macht über mich. Die Mutter macht Teig an dem großen Küchentisch, der mitten im Raum steht. Fasziniert schaue ich den flinken Bewegungen ihrer Hände zu. Kneten, schwungvoll Mehl nachstreuen, kneten, zusammendrücken, wieder kneten. Geübt und sicher sitzt jeder ihrer Handgriffe. Hunderte Male im Leben schon gemacht. Bestimmt ist sie in Gedanken überall, nur nicht beim Teigmachen.
„Nimm das Körbchen und hol Kirschen, saure“, unterbricht sie meine Betrachtungen. „Morgen, kommen die Verwandten vom Dorf herauf, da müssen wir was hinstellen. Bring genug, dann mache ich gleich zwei Kirschkuchen, dann haben wir an beiden Tagen was zum Kaffee.“
Morgen am Sonntag, heißt es für unsere Familie früh aufstehen. Zuerst in den Stall, das Vieh versorgen, dann Frühstück machen, sich selbst schnell sonntäglich herrichten, in die Kirche gehen, gleich wieder nach Hause laufen, Mittagessen kochen, – fünf Leute hatten Hunger – , abwaschen und endlich – frei. Zwei Stunden frei – herrliche Stunden! Sonja und ich – frei für die Obstgärten, frei für die Wiesen, frei für den Wald. Auf Bänkchen sitzen, die Beine baumeln lassen und erzählen. Harmloses, Wichtiges. Sachen, die man nur flüstern durfte, oft mit dem Mund am Ohr der anderen.
Was wir alles machen würden, später, und natürlich wollten wir immer beieinanderbleiben. Das war ja klar! Am besten wir machten auch gemeinsam Hochzeit. Was für ein Aufsehen das in unserem Dorf geben würde. Mit weißen Kleidern und langen Schleiern. Die trugen dann Mädchen mit Blumen im Haar. Wir würden aussehen wie Prinzessinnen. Die Bräutigame wurden zwischen uns stets gerecht verteilt. Einmal ich mit Dieter, dann Sonja mit Günther oder umgekehrt. Uns fielen immer wieder andere Jungs ein, die wir nach Belieben hin und her tauschen konnten.
Ich schlucke, schlucke und schluchze, während ich im Zug sitze, Zeit habe zu denken, und mich meine Gedanken überwältigen. Das gleichmäßige Ratta-ta, Ratta-ta der Räder beruhigt mich wieder und wenn ich genau hinhöre, kann ich sogar Worte heraushören wie: „Ich fahre heim, ich fahre heim, ich fahre heim ...“
Heim! Ich lasse die Erinnerungen zu, wie sie kommen. Wieder bin ich zu Hause in meiner Kindheit! Wie war das noch? Diese Sonntage, die immer so erwartungsvoll anfingen? Um vier Uhr am Nachmittag hieß es, wieder zu Hause sein. Kaffeetisch decken, brav bei den Verwandten sitzen, abräumen, danach mit der Familie den ganzen Hof inspizieren.
„Ja, s’ Vieh steht guat da. Bloß no zwoa Saua? Hent ihr gschlachdet? S’ Heu trocka reibrocht? S’ war jo a Sauwetter, de letschde Däg.“ So in etwa lief die Unterhaltung zwischen dem Besuch und meinen Eltern. „Ja, euer Sach isch ordentlich“, war am Ende das höchste Lob. Die spitzen Kommentare wurden überhört, im Nachhinein im engen Familienkreis aber umso lauter und feindseliger diskutiert!
In bester Stimmung wurde später zum deftigen Abendvesper am Küchentisch Platz genommen. Jedermann langte kräftig zu und genoss die hausgemachten Köstlichkeiten, die Mutter schon am Morgen auf großen Platten zurechtgelegt hatte. Und endlich war es dann auch Zeit für den Heimweg. Ein freundliches Winken auf beiden Seiten und mit behäbigen, festen Schritten machten sich die vom unteren Dorf auf nach Hause. Wenn wir an einer bestimmten Stelle des Hofes standen, konnten wir noch lange sehen, wie sie in den Abend marschierten. Jetzt nur schnell umziehen, melken, Kannen spülen und endlich gehörte der Abend uns.
Wir setzten uns auf die Bank vor dem Haus, mit immer den gleichen Leuten. Sie kamen nach kurzer Zeit aus ihren Häusern, unsere Nachbarn, als hätten sie miteinander eine geheime Verabredung getroffen. Nachbarin Magda und ihr Mann Jakob, der Großbauer Rudolf Hellstern mit seiner Frau Elsa. Jedermann nannte ihn nur den Hektarkönig. Er war der reichste Mann im Ort und wahrscheinlich sogar in der Umgebung. Sein Spruch, der zum geflügelten Wort in der ganzen Gegend geworden war, klingt mir heute noch im Ohr: „Schönheit vergeht, der Hektar besteht!“ Danach war für ihn die Frau ausgesucht worden und so hat er es auch mit seinen Kindern, zwei Söhnen, gemacht. Mit seinem stets breiten, zufriedenen Lächeln lehnte er sich auf der groben Holzbank neben der Haustür zurück, um von Zeit zu Zeit einen tiefen Schluck aus seinem Mostglas zu trinken, das zwischen seinen Füßen auf der Erde stand. Der Hofdreck klebte nach einer Weile an seinem Glas wie Hagelzucker an den Weihnachtsbrötle. Er fuhr immer in gleichmäßigen Abständen mit dem Glasboden über seinen rechten Schenkel. Am Ende der Woche war die Schleifbahn schon von Weitem zu sehen. Sie war ein untrügliches Zeichen, ob die Hose diese Woche gewaschen worden war oder ob seine Frau Elsa gesagt hatte: „Die Hos ziesch nomal an, des duats nomal!“
Читать дальше