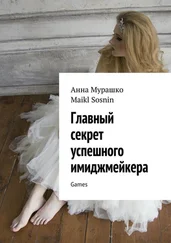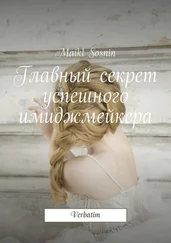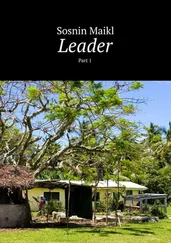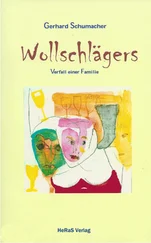Jahrgang 1959, ich habe Ende Juni Geburtstag, um genau zu sein am achtundzwanzigsten. Beginn der Reifezeit unserer Kirschen. Dreizehn glückliche Jahre lebte ich auf dem gesegneten Fleckchen Erde, das ich Heimat nennen darf. Viele unvergessene Tage mit Sonja, in einer Freundschaft, wie sie nur in der Einsamkeit des Landlebens erlebt werden kann. Es war kein anderer da, mit dem wir unsere Freundschaft teilen mussten. Wir beide erlebten gemeinsam unsere Kindertage, unsere Schultage, Geburtstage, Sonntage, Sommer- und Wintertage… Einfach irgendwie fast jeden Tag.
Ich wäre gerne so schön gewesen wie sie. Standen wir beide nebeneinander, war ich zwar anwesend, aber gesehen hat man nur sie. „Bisch du aber a saubers Mädle, du siehsch ja aus wie’s Schneewittchen“. Und so hieß sie dann auch bald „Schneewittchen“. Das stach schon manchmal ein bisschen in der Magengegend, aber doch nur kurz, dann überwog der Stolz, dass ich so eine schöne Freundin hatte.
Meine Gedanken lassen sich nicht mehr aufhalten. Ich möchte sie steuern in eine andere, eine harmlose Richtung, aber sie kommen dem Grauen am Tag vor Fronleichnam 1972 immer näher. Sie sind nicht aufzuhalten, genauso wenig wie der Zug, in dem ich sitze und der mich mit unwiderstehlicher Kraft in Richtung Süden bringt. Ich spüre wieder diese aufgedrehte Unruhe in mir, die mich in den letzten drei Jahren immer wieder mehr oder minder panikartig überfallen hat.
Zuerst dachte ich an eine Schilddrüsenüberfunktion. „Aber nein, es ist nichts, es ist nichts Organisches“, sagte der Arzt, „etwas anderes nagt an Ihnen. Was, das müssen Sie herausfinden und abstellen.“
Ich musste nicht suchen, um das zu finden, was mich belastete, was mich mit aller Macht hinunterzog in diese unbezwingbare Finsternis, die sich vor vielen Jahren in irgendeine Ecke meines Körpers zurückgezogen hatte. Bestimmt hat sie dort gelauert, auf den richtigen Moment gewartet, um bei passender Gelegenheit wieder hervorzukriechen.
Was sagte der Doktor noch? Abstellen? Wie denn? Die längst überwundenen Albträume kamen wieder. Erst schleichend, dann heftiger. Die Bilder waren wieder da. Bilder, die ich glaubte, überwunden und im Griff zu haben. Sie ließen sich nicht mehr zurückdrängen und ich spürte: „Es ist Zeit! Du musst nach Hause, du musst dich den Orten stellen, die du, krank an Leib und Seele, vor vierzig Jahren verlassen hast, verlassen musstest. Ruhig gestellt von den Eltern und dem Doktor Eberwein.“
Viele Jahre später erzählte Mutter immer noch davon, dass ich eines Morgens nicht mehr aufgestanden war. Sie brachten mich dann weg. Weit weg. Nach Berlin. Für mich fühlte sich die große, fremde Stadt an wie ein anderes Land. Ich kam zu einer Frau, die Tante Elvira hieß. Ein Name, der zuvor ab und zu bei Unterhaltungen innerhalb der Verwandtschaft gefallen war. Das war jemand, der mich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht interessiert hatte. Eine Kusine meiner Mutter, der das Schicksal rechtzeitig den richtigen Mann geschickt hatte. Herbert hieß der, ein sogenannter ‚Stromer‘, der mit seinem Arbeitstrupp quer durch Deutschland unterwegs war. Diese Männer mussten draußen auf dem Land die Stromversorgung sichern. In meiner Erinnerung kletterten die Männer mit ihren Steigbügeln auf die hohen Strommasten, legten neue Leitungen, so dass jeder Haushalt an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden konnte.
Ob Herbert anfangs ihr Traummann war, weiß keiner. Auf jeden Fall wurde später erzählt, dass Tante Elvira keinen größeren Wunsch gehabt hatte, als vom ‚Berg‘ wegzukommen. Egal wie! Landwirtschaft war das größte Übel, das es für sie gab. Dazu die strengen Eltern, mit denen sie bis zu deren Tod nicht zurechtkam. Dies ließ sie ihren Entschluss „Nur weg hier und zwar so schnell wie möglich!“ von heute auf morgen in die Tat umsetzen. Herbert war sozusagen der ersehnte Retter, der zur richtigen Zeit aufgetaucht war.
In all den Jahren danach bekam unsere Mutter ab und zu Briefe von ihrer Kusine Elvira oder Postkarten mit Urlaubsgrüßen von irgendwo. Telefonieren kostete damals richtig Geld, also gab es Telefonate nur bei wichtigsten Anlässen. Die Briefe behielt Mutter stets einige Tage in der Tasche ihrer Kittelschürze. Ich nehme an, dass sie der Nachbarschaft vorgelesen wurden. Post aus Berlin, das war was, damit war man dann selber auch schon mit einem Fuß in der großen, weiten Welt. Dagegen bekam Tante Elvira immer mal wieder Zeitungsausschnitte, die Mutter nach Berlin schickte.
So auch über Neuigkeiten von der schlimmen Tat, die in unserem Heimatort passiert war. Die wurden dann mir und unseren Besuchern regelmäßig vorgelesen und die Tante erklärte später dazu passend, dass darum ‚das Kindchen‘ jetzt bei ihr in Berlin war. „Krank vor Angst ist die Barbara geworden. Weil sie den Kerl ja noch immer nicht geschnappt haben, hat es das Mädchen nicht mehr ausgehalten“, erklärte sie genauestens jedem, der sich nach meiner Herkunft erkundigte.
Auch Jahre später schwang immer noch eine Spur Mitleid in der Stimme von Elvira mit. „Nachdem der Herbert endlich weg war, habe ich sie gerne bei mir aufgenommen. Ich hab sowieso recht bald gemerkt, dass der Herbert sein Leben wie früher als lediger Stromer weiterführen wollte. Damit hab ich mich lange genug rumgeplagt!“ An ihrer gelassenen Stimme konnte man erkennen, wie endgültig Tante Elvira mit dem Thema ‚Herbert, der Stromer‘ abgeschlossen hatte. „Gell, Kindchen, es war für dich nicht gerade einfach, vom Dorf weg gleich in die Großstadt Berlin zu ziehen. Aber wir haben es geschafft! Und jetzt ist hier dein Zuhause. Ist doch ein ganz anderes Leben hier. Was hätte sie denn auf dem einsamen Berg schon gehabt? Man sieht ja, was sich dort für Gesindel herumtreibt!“ Wenn Tante Elvira endlich eine Redepause einlegte und mir den Arm um die Schultern legte, musste ich zur Bestätigung nur noch mit dem Kopf nicken und die Tante war zufrieden.
An all das gewöhnte ich mich im Laufe der Jahre. Es schien mir nichts mehr auszumachen, wenn ich von zuhause die neuen Vermutungen und Erkenntnisse der Ermittlungsbeamten mitgeteilt bekam. Nach dem Abitur, das ich mit hervorragenden Noten bestand, fuhr ich zum ersten Mal nach Hause. Fünf Jahre hatte ich bis dahin in Berlin verbracht. Mein Bruder Martin, der älteste von uns Geschwistern, feierte seine Hochzeit, und ich war zusammen mit Tante Elvira eingeladen. Es war für uns beide eine ganz schön aufregende Zeit, die Wochen vor der Reise in die Heimat. Geschenke mussten besorgt und vor allen Dingen die Kleiderfrage musste gelöst werden.
Es war ein schönes Fest, das wir dann erleben durften, aber beide waren wir auch froh, als der Tag unserer Abreise zurück nach Berlin kam. So recht hatten wir mit den meisten der Hochzeitsgäste nicht wirklich etwas anfangen können. Fremd waren sie mir geworden während der langen Zeit der Trennung. Ihre Themen waren nicht die meinen.
Ansonsten merkte ich sehr wohl, dass dem Thema ‚Sonja‘ ausgewichen wurde. Es war für alle gewiss nicht einfach, mir hier zu begegnen. War ich doch als deren beste Freundin die lebende Erinnerung an die grausame Tat. Unter der Oberfläche war das Geschehene noch allgegenwärtig. Die Last der Frage „Wer hat das getan?“ drückte noch immer auf ihre Schultern. Sie litten, die Menschen auf dem Berg, jeder für sich, auf seine Weise, und keiner konnte offen darüber reden.
Weitere Jahre in Berlin folgten, in denen ich mich voll und ganz meinem Jura-Studium widmete, das ich schließlich erfolgreich abschloss. Ohne Mühe bekam ich eine Stelle als selbständig arbeitende Anwältin in einem Berliner Anwaltsbüro. Endlich war genug Geld da für eine eigene Wohnung, ein Auto und Urlaubsreisen mit Freunden in alle Welt. Endlich konnte ich der Mutter mitteilen: „Du musst mich nicht mehr unterstützen, brauchst kein Geld mehr zu schicken an Tante Elvira, für das Wohnen und Essen bei ihr.“
Читать дальше