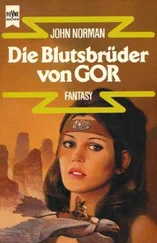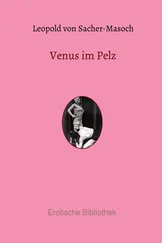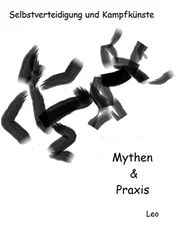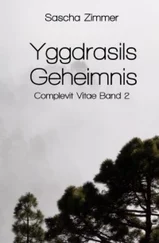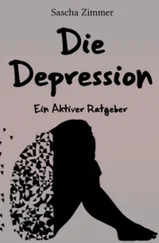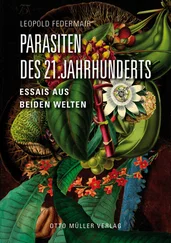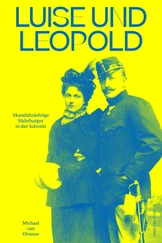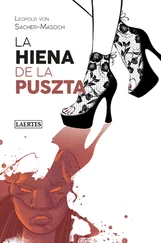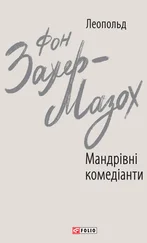Auch die Absicht, mit der die Blutsbrüderschaft in diesem speziellen Fall geschlossen wird, wird in der Gísla saga eindeutig ausgesprochen: aus Trotz gegen ein prophezeites Schicksalsverhängnis („at eigi verði hann sannspár“) beschließen vier – teilweise sogar miteinander verwandte – Männer, ihre Freundschaft noch fester und enger zu machen als bisher („at vér bindum várt vinfengi með meirum fastmælum en áðr“); sie tun dies, indem sie Blutsbrüderschaft schließen.
Die einzige Konsequenz, die in der Gísla saga erwähnt wird, ist die gegenseitige Rachepflicht. Der eine ist verpflichtet, den anderen wie seinen Bruder zu rächen („hverr skal annars hefna sem bróður síns“).
Von ganz besonderer Bedeutung ist die Tatsache, daß diese Stelle zugleich mit einer detaillierten Beschreibung einer „echten“ Blutsbrüderschaft auch den Terminus erwähnt, mit dem im Altnordischen diese Institution bezeichnet wurde, nämlich „fóstbrœðralag“.
4. Saxo Grammaticus: Gesta Danorum
In den Gesta Danorum finden sich mehrere Erwähnungen „künstlicher“ Brüderschaften 43, nur an einer einzigen Stelle wird jedoch expressis verbis gesagt, daß die Brüderschaft durch das Vermischen des Blutes begründet wurde. Dies ist vielleicht dadurch zu erklären, daß SAXO es bei der ersten Erwähnung der Institution für nötig erachtet hatte, etwas genauer darauf einzugehen (er unterstreicht ja auch besonders, daß es sich um einen Brauch vergangener Zeiten handelt), dies aber in allen weiteren Fällen verständlicherweise nicht mehr nötig war. Vermutlich ist bei einigen der in anderen Büchern seiner Gesta Danorum erwähnten Brüderschaften jedoch keine Verbrüderung durch Blutmischung gemeint, sondern es können „Eidbrüderschaften“ oder „Schwurbruderschaften“ ohne Blutritual gemeint sein. 44
Im 1. Buch der Gesta Danorum wird erzählt, wie der jugendliche Hadding, nachdem er seine Pflegemutter verloren hat, Odin begegnet. Odin bedauert ihn ob seiner Einsamkeit und stiftet zwischen Hadding und einem Wikinger namens Liser Blutsbrüderschaft:
Spoliatum nutrice Hadingum grandævus forte quidam, altero orbus oculo, solitarium miseratus Lisero cuidam piratæ solemni pactionis iure conciliat. Siquidem icturi fœdus veteres vestigia sua mutui sanguinis aspersione perfundere consueverant, amicitiarum pignus alterni cruoris commercio firmaturi. Quo pacto Liserus et Hadingus artissimis societatis vinculis colligati Lokero, Curetum tyranno, bellum denuntiant. 45
Die Absicht, mit der die Brüderschaft geschlossen wird, besteht also in der Schaffung eines besonders engen Freundschaftsbundes („amicitiarum pignus… firmaturi“). Die Blutsbrüder sind „artissimis societatis vinculis colligati“.
Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, daß hier Odin selbst als Stifter der Blutsbrüderschaft genannt wird („grandævus forte quidam, altero orbus oculo“).
Ähnlich wie im Alten Sigurdlied wird auch hier erwähnt, daß das Blut der Beteiligten in die „Spuren“ vergossen wurde („vestigia sua mutui sanguinis aspersione perfundere“). Der beiderseitige Charakter dieses „Bluttausches“ wird besonders hervorgehoben („mutui sanguinis aspersione“ – „alterni cruoris commercio“).
Ebenso wie im Alten Sigurdlied wird auch hier nichts davon erwähnt, daß die Blutmischung unter einem „jarðarmen“ stattgefunden habe.
SAXO bezeichnet das Verhältnis zwischen den Blutsbrüdern mit dem Ausdruck „fœdus“: der juristische Aspekt ist ihm offenbar wichtig, denn die Blutsbrüderschaft wird unmißverständlich als ein besonders feierlicher Rechtsvertrag definiert („solemni pactionis ius“).
Besonders in den Fornaldarsögur ist sehr häufig von „fóstbrœðr“ und der Institution des „fóstbrœðralag“ die Rede; nur zweimal jedoch wird erwähnt, daß das fóstbrœðralag durch Blutmischung geschlossen wurde. 46
5. Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana
Ásmundr berserkjabani erzählt sein Leben: nach dem Bericht von Kindheit und Jugend schildert er, wie er sich einmal auf der Jagd verirrte und dabei mit Árán von Tattaríá zusammentraf. Nachdem sie beide miteinander gekämpft hatten, schwören sie sich Blutsbrüderschaft:
Þá talaði Árán til Ásmundar: ‚Ekki skulu vit vapnaskipti
prófa, Því Þat verðr skaði okkar beggja. Vil ek, at vit
sverjumz í fóstbrœðralag; at hvárr skal annars hefna, ok
eiga fé saman, fengit ok ófengit.‘ Þat fylgði ok svardaga
Þeirra, at hvárr sem lengr lifði, skyldi láta verpa haug
e  tir annan, ok láta Þar í svá mikit fé, sem Þeim pætti
tir annan, ok láta Þar í svá mikit fé, sem Þeim pætti
sóma. Sian skal sá, sem lengr lifir, sitja hjá enum dauða
III nætr í haugi, ok fara síðan burt, ef hann vildi.
Voktu sér síðan blóð, ok létu renna saman; heldu
menn Þat Þá eiða. 47
Der Vorschlag, Blutsbrüderschaft zu schließen, geht von Árán aus („vil ek, at vit sverjumz í fóstbrœðralag“).  uch hier wird die Eingehung des Bundes mit der Wendung „sveria í fóstbrœðralag“ bezeichnet.
uch hier wird die Eingehung des Bundes mit der Wendung „sveria í fóstbrœðralag“ bezeichnet.
Über das Ritual wird nur gesagt, daß sie sich „das Blut weckten“ und es zusammenfließen ließen („voktu sér síðan blóð, ok létu renna saman“). Weder die Fußspuren noch das jarðarmen werden erwähnt. Mit diesen Worten war die Blutmischung schon in der bedeutend älteren Gísla saga beschrieben worden („… ok nú vekja Þeir sér blóð ok láta renna saman“). Dies könnte auf eine literarische Übernahme deuten.
Anders verhält es sich bei den Konsequenzen, die aus der Blutsbrüderschaft entspringen. Hier ist die Egils saga einhenda bei weitem ausführlicher als die Gísla saga: neben der Rachepflicht („hvárr skal annars hefna“) erwähnt sie außerdem, daß den Blutsbrüdern ihr Besitz gemeinsam gehören soll, und zwar nicht nur all das, was sie derzeit ihr Eigentum nennen, sondern auch alles, was sie erst in Zukunft erwerben werden („eiga fé saman, fengit ok ófengit“). Darüber hinaus soll der Überlebende für den Verstorbenen den Grabhügel aufwerfen lassen und ihm so viele Grabbeigaben mitgeben, als ihm geziemend erscheint („hvárr sem lengr lifði, skyldi láta verpa haug eptir annan, ok láta Þar í svá mikit fé, sem Þeim pætti sóma“) und endlich ist der Überlebende verpflichtet, drei Nächte bei seinem toten Blutsbruder im Grabhügel zu verbringen; dann kann er fortgehen, wenn er dies will („skal sá, sem lengr lifir, sitja hjá enum dauða III nætr í haugi, ok fara síðan burt, ef hann vildi“).
Dieses Motiv vom Mitbegraben, das dann in dieser Saga zu einem schrecklichen Kampf zwischen dem Toten und dem Lebenden führt, findet sich schon in der Geschichte von Asmund und Aswit, die SAXO GRAMMATICUS im 5. Buch seiner Gesta Danorum berichtet. 48Die entsprechende Erzählung der Egils saga einhenda ok Asmundar berserkjabana ist höchstwahrscheinlich aus der selben nordischen Vorform entsprungen wie die Geschichte SAXOs. 49Allerdings erwähnt SAXO nichts davon, daß die Verbrüderung durch eine Blutmischung erfolgt sei. Der Verfasser der Egils saga einhenda hat das bei SAXO geschilderte Freundschaftsverhältnis jedoch offenbar als ein solches von Blutsbrüdern aufgefaßt und es dementsprechend in seiner Erzählung mit den fast stereotyp wiederkehrenden Elementen kurz charakterisiert. Die Beschreibung dieser Blutsbrüderschaft könnte geradezu als eine Synthese zweier Vorlagen angese  en werden: der Grundstruktur des Berichts in Anlehnung an die Quelle von SAXOs Buch V, und einer Ergänzung und Verdeutlichung nach der „klassischen“ Beschreibung eines fóstbrœðralag in der Gísla saga und anderer Sogur. Sollte dies der Fall sein, dann wäre der Aussagewert dieser Stelle der Egils saga einhenda nicht sehr hoch anzusetzen. Vielleicht läßt sich aus ihr jedoch schließen, daß das bei SAXO beschriebene Freundschaftsverhältnis Asmunds und Aswits tatsächlich eine Blutsbrüderschaft war.
en werden: der Grundstruktur des Berichts in Anlehnung an die Quelle von SAXOs Buch V, und einer Ergänzung und Verdeutlichung nach der „klassischen“ Beschreibung eines fóstbrœðralag in der Gísla saga und anderer Sogur. Sollte dies der Fall sein, dann wäre der Aussagewert dieser Stelle der Egils saga einhenda nicht sehr hoch anzusetzen. Vielleicht läßt sich aus ihr jedoch schließen, daß das bei SAXO beschriebene Freundschaftsverhältnis Asmunds und Aswits tatsächlich eine Blutsbrüderschaft war.
Читать дальше
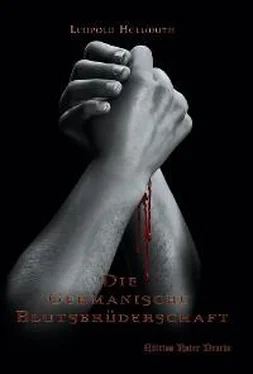
 tir annan, ok láta Þar í svá mikit fé, sem Þeim pætti
tir annan, ok láta Þar í svá mikit fé, sem Þeim pætti uch hier wird die Eingehung des Bundes mit der Wendung „sveria í fóstbrœðralag“ bezeichnet.
uch hier wird die Eingehung des Bundes mit der Wendung „sveria í fóstbrœðralag“ bezeichnet. en werden: der Grundstruktur des Berichts in Anlehnung an die Quelle von SAXOs Buch V, und einer Ergänzung und Verdeutlichung nach der „klassischen“ Beschreibung eines fóstbrœðralag in der Gísla saga und anderer Sogur. Sollte dies der Fall sein, dann wäre der Aussagewert dieser Stelle der Egils saga einhenda nicht sehr hoch anzusetzen. Vielleicht läßt sich aus ihr jedoch schließen, daß das bei SAXO beschriebene Freundschaftsverhältnis Asmunds und Aswits tatsächlich eine Blutsbrüderschaft war.
en werden: der Grundstruktur des Berichts in Anlehnung an die Quelle von SAXOs Buch V, und einer Ergänzung und Verdeutlichung nach der „klassischen“ Beschreibung eines fóstbrœðralag in der Gísla saga und anderer Sogur. Sollte dies der Fall sein, dann wäre der Aussagewert dieser Stelle der Egils saga einhenda nicht sehr hoch anzusetzen. Vielleicht läßt sich aus ihr jedoch schließen, daß das bei SAXO beschriebene Freundschaftsverhältnis Asmunds und Aswits tatsächlich eine Blutsbrüderschaft war.