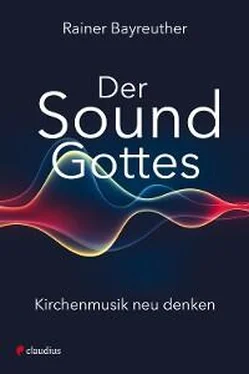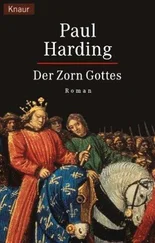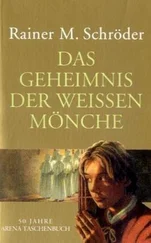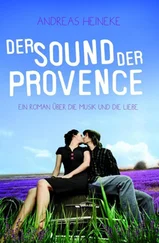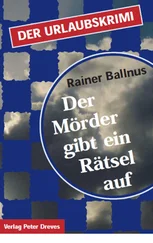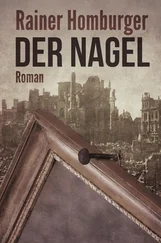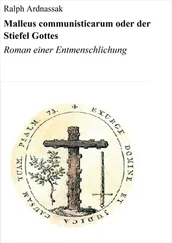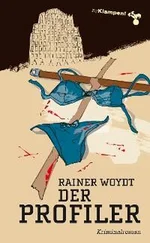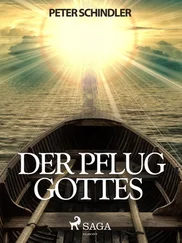Die roten Karten
– Musik als gute „Gabe Gottes“, so schon Martin Luther frei nach Jakobus 1,17, ein Vers, den man auch als Liedstrophe und Tischgebet kennt. Die Musik reiht sich damit ein in andere Gottesgaben wie dem Apfel aus dem Garten Eden, dem Feuer oder dem Sex. Man kann sie zum Guten und zum Schlechten gebrauchen. Daher immer den Jakobusvers mitbedenken, dann werden sie Heil und Segen stiften.
– Musik als Talent. Gute Gaben sollen, siehe Matthäus 25,14ff. und Lukas 19,12ff., aber bitte auch genutzt werden und nicht aus lauter Angst brach liegen bleiben.
– „Überall drücken sich in Musik tiefste Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste aus.“ Dieser Gedanke hat seinen rechten Platz auf den roten Karten, auch wenn das nicht gleich in die Augen springt. Die tiefen Sehnsüchte weisen aus, dass der Mensch unbedingt auf Gott bezogen ist (Schleiermacher). Andererseits ist der Mensch radikal von Gott getrennt (Karl Barth). Ein echtes Dilemma, mit dem die dicksten Theologenbücher in Verlegenheit zu bringen sind. Aber Gott sei Dank hat der Herr ein Schlupfloch gelassen. Die Musik. Und zwar „überall“.
– „Die evangelischen Kirchen in Deutschland sind musikalisch reiche Kirchen.“ Reichtum, ein rundum sorgenfreies Thema. Bevor wir uns auf ihm ausruhen dürfen, müssen wir noch ein paar Fragen stellen. Was zum Beispiel ist mit den Präludien und Fugen im XXL-Format, die uns der Heilige Sebastian geschenkt hat? Die seinerzeitige Thomaskirchenleitung wollte sie gar nicht in der Kirche haben. Manche Stücke sind einfach zu reich für die Kirche. Was ist mit dem Orgelschatz , wie ein gewisser Carl August Kern im 19. Jahrhundert gleich sechs Bände mit anspruchslosesten Orgelstückchen nannte? Das ist der Reichtum einer dicken Sammelbüchse mit Kleingeld, die am weitesten verbreitete Vermögensstruktur der Kirchenmusik. Woher stammen so wertstabile Assets wie Schütz, Bach, Händel und Mendelssohn? Schütz hat die italienische Oper beerbt, Bach und Händel schreiben von sich selber ab, der schmächtige Mendelssohn steht auf den Schultern des Riesen Mozart. Woher die Sakropopsternchen ihren Pop haben, fragen wir lieber nicht so genau nach. Wenn man unter Reichtum auch die Dividende aus lukrativen Beteiligungen gelten lässt, dann ist die evangelische Kirchenmusik ein Big Player am Markt.
– Der „reiche Schatz der Kirchenlieder“: Mit dieser Floskel landet man besonders viele Treffer im evangelischen Schrifttum. Dürfen wir es wagen zu fragen, wie es um den Wohlstand derer steht, die den Schatz erarbeitet haben? Die vielen Kirchenlieddichter sind nun wirklich anständig entlohnt worden: als Pfarrer (Paul Gerhardt), Gymnasiallehrer (Nikolaus Herman), Theologieprofessor (Dietrich Bonhoeffer). Da kann man nicht meckern. Von Geburt reiche Frauen wie Henriette Catharina von Gersdorff stellten ihr Dichtertalent, das sie nicht vergruben, der Kirche kostenlos zur Verfügung. Achtsam sein sollten wir freilich für die Lage derer, die den musikalischen Teil der Kirchenlieder beisteuerten. Also die Musik im engeren und eigentlichen Sinn. Da sieht es prekär aus: Hilfslehrer (Friedrich Silcher), Hauslehrer (Georg Neumark), lausig besoldete Kapellmeister (Johann Balthasar König, Adam Krieger, Johann Hermann Schein), freischaffende Chorleiter und Lektoren (Paul Ernst Ruppel). Wohl den Pfarrern, die im auskömmlichen Theologenstand komponierten (Kurt Rommel, Samuel Rothenberg, Otto Riethmüller, Dieter Trautwein).
Die blauen Karten
Auf der blauen Überschriftenkarte steht „Vom Ich zum Du“. Wenn Ihnen das zu gestelzt vorkommt, schreiben Sie „Gemeinsam singen“.
– Das g-Wort fällt in jedem Gottesdienst, meistens auch beim Singen. Die Gemeinsamkeit ist dem Singen vorgeordnet. Aber nicht nur dem Singen, es gibt „auch gemeinsame passive Praktiken wie das Hören, das Hier-Sitzen und das Schweigen“.
– Zugleich ist das Gemeinsame dem Singen nachgeordnet. Kirchenmusik „schult eine elementare Hör- und Ausdrucksfähigkeit, die immer auch Hör- und Ausdrucksfähigkeit füreinander ist“. Dass beim Singen das herauskommt, was wir einen Spiegelstrich weiter oben in das Singen hineingesteckt haben, sollte nicht weiter beunruhigen. Es ist oft so in der Theologie, dass man mit viel Hallo und Halleluja die Ostereier findet, die man vorher selber versteckt hat.
– Beim Thema Corona empfehle ich vorerst abzuwiegeln. Es bringt nichts, jetzt schon das Pest-oder-Cholera-Dilemma zu thematisieren, in dem die Kirche steckt, entweder mit dem Gemeinschaftsmantra aufzuhören oder Corona zum Teufelswerk zu erklären.
Die grauen Karten
– Wieder macht Luther den Aufschlag: Kirchenmusik ist eine „Lehrmeisterin“. Weniger altmodisch gesagt, sie „nimmt einen Bildungsauftrag wahr“. Man internalisiert alles sofort und ohne Zeigefinger. „Musik beeinflusst unser Fühlen und Denken, sie kann Worte und Ideen weitertragen.“ Sieht man die Sache so, dann kommt es freilich darauf an, welche Worte man der Musik auf die Pritsche packt. Daher sollte man die Kirchenmusik nie nur den Musikern überlassen. Denen ist das nämlich herzlich egal.
– Kirchenmusik „kann auch zum äußeren Frieden beitragen.“ Dieser Klassiker aller musikalischen Sonntagsreden darf in der Kirche nicht fehlen. Aber das ist freilich mit Arbeit verbunden. „Die kirchenmusikalischen Arbeitsformen beteiligen sich vielfältig an dieser friedensstiftenden Kulturarbeit.“ Auch der Krieg allerdings ist ein beliebter Reiter der Musik. Sogar einer, der weniger Arbeit macht.
– „Musik ist nicht selbst göttlich, sie dient Gott – und sie dient darin zugleich den Menschen.“ Das „zugleich“ ist ein astreines Theologenwort. Aber bevor uns die dicken Bücher wieder in den Sinn kommen und Schläfrigkeit uns übermannt, wollen wir den Gedanken heute nicht weiter vertiefen.
– „Musik in der Kirche ist eine Form des Gottesdienstes.“ Bevor daraus jemand freche Schlüsse zieht, sei hinterhergesagt, dass „aller Einsatz von Musik daran gemessen werden muss, ob er wirklich dem Gottesdienst dient oder andere Ziele verfolgt.“ Unlogisch? Egal, wir sitzen doch im Stuhlkreis und nicht im Oberseminar Analytische Ontologie.
Die gelben Karten
– Beginnen Sie ganz niederschwellig: „Das Singen der Lieder hat eine sinnlich belebende Wirkung.“ Saul und David, Sie kennen die Geschichte. Das Thema ist perfekt geeignet, die Verspanntheit der Kirchenmusik zwischen Gott, Mensch, Himmel und Hölle herunterzubrechen auf Workshopformat.
– Die folgenden Wirkungen der Musik bedürfen gegebenenfalls der fachmedizinischen Begleitung: „Musik kann trösten, aus Verbitterung und Trauer herausreißen und zum Leben umstimmen. Sie kann […] Traumzeiten stimulieren, Verkrampfungen und Ich-Fixierungen lösen und Beziehungen stiften.“ Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und beachten Sie, dass eventuell Gebühren der Partnervermittlungsagentur anfallen.
Die grünen Karten
– Kirchenmusik „schult eine elementare Hör- und Ausdrucksfähigkeit“. Dass sich bei den Begriffen Schulen und Fördern die Propheten des Alten Testaments und gottbegnadete Musiker wie Mozart im Grab herumdrehen, können wir jetzt gelassen kontern: Wir haben das Heft des Handelns wieder in der Hand. Wir tun was, anstatt ehrfurchtsvoll und folgenlos vor den Heroen zu erstarren.
– „Musik fördert Klugheit, soziale Kompetenz, Kreativität und Gemeinschaftsfähigkeit.“ Kürzer und kirchlicher: „Lieder fördern Geist und Seele.“ Wer jetzt rückfragt, was Klugheit, Sozialkompetenz und Kreativität nochmal genau mit dem Christentum zu tun haben, dem antworten Sie: Selbstverständlich sind diese Skills auch im normalen Leben von Vorteil. Es geht um Dienst. Es geht darum, sie in den Dienst Gottes und des Gottesdiensts zu stellen. Und dazu dient am Ende auch die Musik. Musik wäre hier also ein Gottesdienst-Dienst-Dienst.
Читать дальше