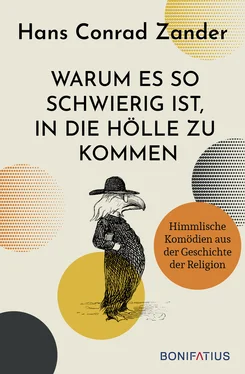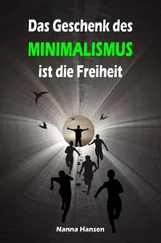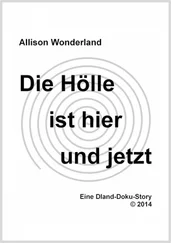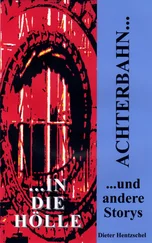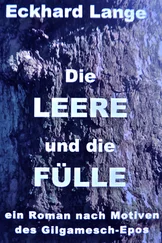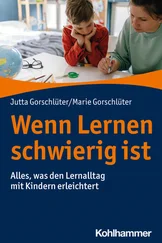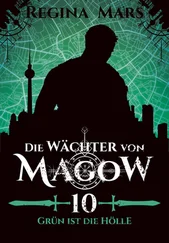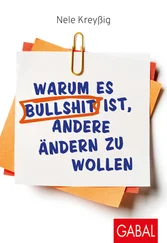Was ist los mit Justinian?
Das Einfachste von der Welt: die Liebe. Die große, starke Liebe. Dass ein Mann und eine Frau einander leidenschaftlich lieben, ist etwas, was wir uns heute, im 21. Jahrhundert, kaum noch vorstellen können. Die Menschen der byzantinischen Zeit waren anders. Vom Bosporus bis nach Ägypten waren sie ungleich sinnlicher als wir.
Unmöglich war dagegen die Ehe, doppelt unmöglich. Schauspieler, Tänzerinnen, Prostituierte waren nach byzantinischem Recht „ehrlos“. Wohl durften sie unter sich heiraten, doch keineswegs hinauf in ehrbare Familien. Und in ganz Konstantinopel gab es keinen ehrbareren Heiratskandidaten als Justinian.
Strenger noch als das Gesetz war die Sitte. Die Sitte verkörperte sich in Konstantinopel in Kaiserin Euphemia. Dass so eine ihr nachfolge auf den glänzendsten aller Throne, dies will Kaiserin Euphemia unbedingt verhindern.
Doch die göttliche Vorsehung hält es mit den Liebenden. Kaiserin Euphemia stirbt unerwartet. Jetzt lässt sich der hochbetagte Kaiser von seinem Neffen ein neues Gesetz aufschwatzen, eine Lex Theodora. Wenn sie sich reuig zeigen und Buße tun, dürfen gefallene Mädchen künftig ehrbare Männer heiraten.
Es ist das Jahr des Heils 525. Die Hagia Sophia strahlt im Licht von tausend Kerzen, tausend Lampen, als Patriarch Epiphanios die beiden zusammengibt zum heiligen Ehebund: Justinian und Theodora, Theodora und Justinian.
Zwei Jahre später stirbt auch der Kaiser. Justinian folgt ihm nach auf den Thron. Sofort erhebt er Theodora zur Augusta, zur Kaiserin an seiner Seite. Städte und Provinzen benennt er nach ihrem Namen. Er überhäuft sie mit Edelsteinen, mit Palästen, mit Landgütern, mit jedem nur denkbaren Luxus. Ist diese Frau vielleicht nicht mehr als seine Luxuskreation?
13. Januar 532. In Konstantinopel bricht die Revolution aus. Die „große Zirkus-Revolution“. Was ist passiert? Kaiser Justinian hat gesiegt. Er hat zuviel gesiegt. Den ganzen verlorenen Westen des alten Römischen Reiches hat er zurückerobert. Maßlos teuer waren all diese Siege. So ist dem byzantinischen Staat das Geld ausgegangen. Im Zirkus von Konstantinopel begehrt das empörte Volk nicht mehr nur nach Spielen, sondern nach Brot.
Aus der Arena wälzt sich die entfesselte Menge zur Hagia Sophia. Die größte, die schönste Kirche der Christenheit geht auf in hellen Flammen. Die wunderbaren Paläste, die Kirchen von Konstantinopel, sie brennen alle, eine nach der andern. Jetzt will Kaiser Justinian die Aufständischen besänftigen. Mit einer ungewöhnlichen Geste. Mit christlicher Demut. In der Kaiserloge des Zirkus tritt er vor sein empörtes Volk. Das heilige Evangelienbuch in Händen bekennt er seine Sünden, ruft zur Ordnung auf und verspricht den Aufständischen eine vollständige Amnestie. Von allen Seiten schallt ihm nur, immer lauter, der Ruf entgegen: „Justinianos onos! Du Esel von Kaiser, Justinian.“
Schon werden die Tore seines Palastes eingeschlagen, schon steht die Vorhalle in Flammen, da ruft der Kaiser den engsten und höchsten Rat des Reiches zusammen. „Silentium“ wurde diese Beratung genannt, weil nur der Kaiser reden durfte und alle andern schweigend zuzuhören hatten. Alles sei verloren, sagt Justinian, es gebe nur noch die Flucht.
In diesem Augenblick geschieht das Unerhörte. Eine Stimme durchbricht das Silentium. Es ist die Stimme einer Frau. In ihrem Purpurmantel ist Kaiserin Theodora aufgestanden, um ihrem Gatten, dem Kaiser, zu widersprechen. Wenn er fliehen wolle, so solle er fliehen. „Das Schiff“, sagt sie, „steht bereit und Geld ist vorhanden.“ Sie aber werde nicht fliehen. „Ich ziehe den Tod im Purpurmantel dem schmachvollen Leben auf der Flucht vor.“
Im Zirkus von Konstantinopel ist sie aufgewachsen. Zwischen allen Käfigen von Löwen und Bären, die auf den sicheren Tod warteten. Theodora weiß, dass dies eine Arena ist, in der mit christlicher Demut nichts auszurichten ist. Als jetzt die Revolutionäre sich wieder im Zirkus versammeln und einen Gegenkaiser ausrufen, gibt Theodora den letzten noch loyalen Truppen den Befehl, das eine Zirkustor abzusperren und die Arena vom andern Tor her zu stürmen. Sämtliche Revolutionäre, etwa 30.000 insgesamt, werden niedergemetzelt. Die große Zirkusrevolution von Konstantinopel ist beendet. In den rauchenden Ruinen der Stadt aber greifen die byzantinischen Hymnendichter tief in die Leier:
„Alles, was lebt, besingt dich, o Herrscherin. Machtvoll hast du die Menge der Feinde vernichtet.“
Justinian und Theodora: Er hat sie auf den Thron gehoben, jetzt gibt sie ihm seinen – den schon verlorenen – Thron zurück. Zusammen bauen die beiden das zerstörte Konstantinopel wieder auf, auch die Hagia Sophia, größer und schöner als jemals zuvor. Auch als ihm die Ärzte berichten, Theodora werde ihm, der vielen Abtreibungen in Zirkustagen wegen, keinen Sohn mehr gebären können, verstößt er sie nicht. Ihn selbst geben die Ärzte auf, als ihn die große Pest von Konstantinopel niederwirft. Es ist Theodora, die ihn, rücksichtslos gegen sich selbst, gesundpflegt.
Justinian und Theodora, Theodora und Justinian: Was kann diese beiden noch entzweien? Nur eines. Ihr ahnt es schon: die Religion.
In reiferen Jahren interessiert sich Kaiserin Theodora zunehmend für die Feinheiten der dogmatischen Theologie. Das wichtigste christliche Dogma hatte das Konzil von Chalzedon festgelegt: „Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch.“ Eine Person mit zwei Naturen, einer göttlichen und einer menschlichen. Kaiserin Theodora versteht das anders. Wie so viele ihrer Untertanen in Syrien und Ägypten, ist sie Monophysitin: Jesus Christus hat nur eine, die göttliche Natur. Das Menschliche an ihm war zeitweilige irdische Erscheinung.
Justinian tut jetzt, was wohl jeder Ehemann tut, wenn seine Frau dogmatische Ambitionen entwickelt: Der Kaiser hüllt sich in byzantinisches Schweigen. Nicht so der Papst in Rom. Traditionell sind ja beide, Kaiser und Papst, Hüter des Dogmas von Chalzedon. Feierlich verurteilt Papst Silverius Theodoras dogmatische Erleuchtung als Ketzerei.
Die Kaiserin nimmt ihm das so übel, als wär´s eine zweite Zirkus-Revolution, diesmal in Rom. Auf ihren Befehl wird Papst Silverius entführt, abgesetzt, geschoren, in eine schwarze Büßerkutte gesteckt und als Einsiedler – darf ich es so sagen, wie es ist? – nach Anatolien entsorgt. Nach ihrem dogmatischen Gusto wird ein neuer Papst, Vigilius, ernannt. Der wird aber leider rückfällig und bekräftigt erneut, der Kaiserin zum Trotz, das Dogma von Chalzedon: „Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch.“
Am 28. Juni 548 ist Kaiserin Theodora gestorben. In den Kirchen des Ostens, bei den Kopten vor allem, wird sie bis heute als ganz große Heilige verehrt. Am 14. November ist ihr Festtag. Nur der Vatikan weigert sich immer noch, die Frau, die stark genug war, den Papst zu stürzen, zur Ehre der katholischen Altäre zu erheben.
Schon aber hat die Unesco in Paris den ersten Schritt getan. Das grandiose byzantinische Mosaik in der Kirche San Vitale von Ravenna, der einstigen oströmischen Kapitale für Italien, hat sie zum Weltkulturerbe erklärt. Es zeigt Kaiserin Thedora mit Perlen behangen, mit Edelsteinen gekrönt in überirdischer Verklärung. Bildungstouristen ohne Zahl ziehen andächtig vor diesem gewaltigen byzantinischen Mosaik vorbei. Wann wird Papst Franziskus den Mut finden, selber nach Ravenna zu pilgern, um, stellvertretend für uns alle, vor Theodoras überweltlichem Bildnis das Knie zu beugen?
Heilige Theodora von Byzanz, bitt für uns Sünderinnen und Sünder!
„Adieu in alle Ewigkeit, mi Cicero!“
Worin wir von Petrarca lernen, wie man alte weiße Männer kulturell cancelt .
Nicht erst mit sechzig oder siebzig, nein schon mit vierzig Jahren galt ein Mann im Alten Rom als „senex“, als Greis. Einundsechzig Jahre alt war Marcus Tullius Cicero, als er sich im Jahr 45 vor Christus entschloss, ein Buch über das Greisenalter und über den näherkommenden Tod zu schreiben: „de senectute“. Das heißt, mit dem Altwerden und mit der Erwartung des Todes hatte Cicero zu dieser Zeit schon viel eigene Erfahrung. Mehr noch hatte er sich die Meinungen anderer anhören müssen: vor allem die bitteren Klagen der Alten selber.
Читать дальше