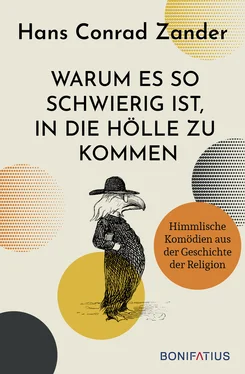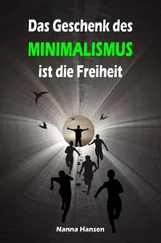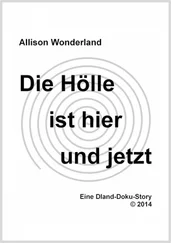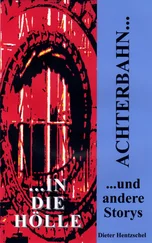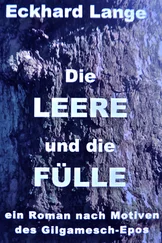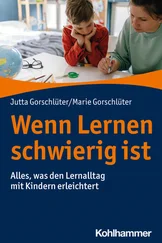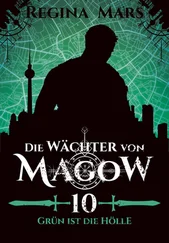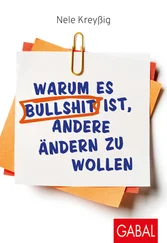Was jetzt beginnt, ist eines der klassischen Motive der abendländischen Malerei: Hieronymus ganz allein im Exil zu Bethlehem. Hieronymus der Einsiedler, versunken ins Studium und ins Gebet. „Hieronymus im Gehäuse“, so haben sich das die Maler später vorgestellt. So hatte sich das wohl auch der heilige Hieronymus selber vorgestellt, als er aus Rom nach Bethlehem floh. Doch er hatte, nicht ganz zufällig, seine zölibatäre Rechnung ohne die Frauen gemacht.
Während sich nämlich der heilige Hieronymus in seinem Gehäuse in Bethlehem gemütlich einrichtete, froh, den ganzen Tag Zeit und Ruhe zu haben fürs Schreiben, herrschte daheim in Rom, im Salon der heiligen Paula, die größte Unruhe: War es nicht verantwortungslos gewesen, den heiligen Hieronymus allein abreisen zu lassen? Würde er zurechtkommen, ein hilfloser Intellektueller wie er, einsam im Exil?
Alsbald stach ein Schiff in See. An Bord Hunderte von Jungfrauen und Witwen aus den vornehmsten Kreisen. Die gesamte römische Frauenbewegung war aufgebrochen. Auf der Kommandobrücke, samt ihren Töchtern Eustochia und Blaesilla, die heilige Paula. Auf zum heiligen Hieronymus!
Hieronymus hatte sich in Bethlehem niedergelassen, um die gesamte Heilige Schrift aus dem Hebräischen und dem Griechischen ins Latein zu übersetzen. Diese Übersetzung, die „Vulgata“, hat er auch vollendet. Moderne Exegeten freilich lassen an der Bibel des heiligen Hieronymus kein gutes Haar. Die Übersetzung sei voll von Schludrigkeiten, von Auslassungen, von krassen Fehlern.
Wen wundert das? Während Hieronymus die Bibel übersetzte, herrschte, rings um sein Gehäuse, nicht himmlische Ruhe, sondern höllischer Baulärm. Nach kurzem Augenschein in Bethlehem war die heilige Paula nämlich zu dem Schluss gekommen, dass der große Zölibatsapostel zu unselbständig sei, um allein im Exil zu leben. Dass er der Betreuung bedurfte. Und sie begann zu bauen.
Nach ihrem Prinzip „Geld spielt keine Rolle“ stampfte die heilige Paula drei große Frauenklöster aus dem Sand, die das winzige Gehäuse des heiligen Hieronymus von allen Seiten machtvoll umwallten. Sogar so etwas wie ein antikes Telefon, oder besser: eine antike Faxverbindung, installierte die heilige Paula, nämlich einen stündlichen Kurierdienst zwischen ihrer eigenen Zelle und dem Gehäuse des heiligen Hieronymus. Stündlich von der heiligen Paula inspiriert, stündlich von ihr gemanagt, schrieb der heilige Hieronymus fortan einen Traktat „De Virginitate“ („Über die Keuschheit“) nach dem andern. Finanziert von der heiligen Paula überfluteten seine Streitschriften für den Zölibat aus Bethlehem das Römische Reich.
Es ist jetzt wichtig zu wissen, dass es im Altertum einen blühenden Bildungstourismus gab. Zur Bildung eines jungen Römers gehörte eine Reise nach Ägypten. Vor allem für höhere Töchter aus gutem Hause war Ägypten ein kulturelles Muss.
Plötzlich war eine Bildungsreise nach Ägypten nicht mehr denkbar ohne einen frommen Abstecher nach Bethlehem. Hieronymus selber beschreibt das ungeheure Gewimmel suchender junger Menschen, die bald danach aus dem ganzen Imperium in Bethlehem zusammenströmten. Als wäre es das Taizé der Antike.
Genau wie heute in Taizé um Frère Alois, genauso andächtig saßen die jungen Christinnen und Christen in Bethlehem dem heiligen Hieronymus zu Füßen. Und wenn abends die Lagerfeuer aufloderten, stiegen aus unzähligen Kehlen die Lieder der neuen Jugendbewegung zum Himmel. Es müssen, nach italienischen Forschungen, mehrere tausend gewesen sein, die wie Schlager ums Mittelmeer gingen, begeistert von Mund zu Mund: Lieder vom Zölibat und von der Jungfräulichkeit – Lieder von Jesus, dem ersten keuschen Mann: „Jesu, corona virginum …“.
Ob solchen Klängen verging den spätantiken Machos, daheim in Rom, Hören und Sehen. Mit ein paar linken Intellektuellen waren sie leicht fertiggeworden, mit einer Frauenbewegung zur Not auch. Mit einer Jugendbewegung aus Bethlehem aber hatte keiner gerechnet. Eine Jugendbewegung für Keuschheit und Zölibat, das war zu viel. Zuerst kippte die öffentliche Meinung in Alexandrien. Dann kippte sie in Rom selbst. Am 30. September 419, als der heilige Hieronymus in seinem Gehäuse zu Bethlehem steinalt starb, hatte die cloaca maxima am Tiber sich geläutert zum Jungbrunnen des Zölibats.
Der Triumph des heiligen Hieronymus, der Triumph der christlichen Keuschheit gilt als eine der erstaunlichsten Umwälzungen der europäischen Kulturgeschichte. Und doch könne man sich in diesem Falle alle komplizierten Erklärungen sparen, meint Havelock Ellis, der große englische Sexualforscher.
Der heilige Hieronymus hat gesiegt, weil er die stärkere Sache vertrat. So geistlos, meint Ellis, sei die Sexgläubigkeit der späten Antike gewesen, so abgestanden der ordinäre Konformismus der Schamlosigkeit, dass das Keuschheits-Experiment der heiligen Paula und des heiligen Hieronymus die Jugend anziehen musste mit dem unerhörten Reiz des Revolutionären. Nur deshalb, schreibt Ellis wörtlich, hat die Keuschheit aus Bethlehem Europa erobern können, weil ihr der Zauber eines neuen Erlebnisses eignete, einer herrlichen Freiheit und eines ungeahnten Abenteuers:
“If, indeed, it had not possessed the charm of a new sensation, of a delicious freedom, of an unknown adventure, it would never have conquered the European world.”
Die Versuchungen des heiligen Antonius
Worin wir lernen, wovor ein echter Mann die Flucht ergreifen soll .
Warum ist eigentlich der heilige Antonius in die Wüste geflohen? Kaum eine Frage scheint so müßig wie diese. Weiß doch jeder gebildete Christ: Der heilige Antonius ist in die Wüste geflohen, weil er Angst hatte vor den Frauen.
Wer das zu bezweifeln wagt, bekommt prompt den Vorwurf zu hören, er sei wohl noch nie in einem Museum gewesen. Haben doch Hunderte von Malern den heiligen Antonius alle gleich gemalt: wie er als Einsiedler, weit draußen in der Wüste Ägyptens, vergeblich Ruhe vor den Frauen sucht. Gerade dort, wohin kein Weib aus Fleisch und Blut sich je verirren würde, in jener äußersten Einsamkeit, plagen den heiligen Antonius, Tag und Nacht, betörende Trugbilder weiblicher Reize. Ihn plagt die eigene lüsterne Phantasie. O die „Versuchungen des heiligen Antonius”! Von Hieronymus Bosch bis zu Mathias Grünewald, von Salvador Dalí bis zu Max Ernst, sind sie eines der großen, klassischen Themen der europäischen Malerei.
Und doch beschleicht gerade den erfahrenen Freund der Schönen Künste angesichts so vieler so schön gemalter „Versuchungen des heiligen Antonius” ein leiser historischer Zweifel. Schließlich war Antonius der Einsiedler ein Ägypter des 3. Jahrhunderts; die unzähligen Maler, die uns seine erotischen Phantasien vorgemalt haben, sind alle mindestens tausend Jahre später in Europa zur Welt gekommen. Die Gnade der späten Geburt ist aber selten verbunden mit dem Sinn für die historische Wirklichkeit. Überdies leiden Maler vor der Staffelei oft an Langerweile. Dass sie dann selber heimgesucht werden von tausend lüsternen Phantasien, ist nicht weiter schlimm. Dass daraus dann doch schöne Heiligenbilder werden, ist sogar erfreulich. Aber sagt es auch nur irgendetwas aus über die historische Wirklichkeit?
Für das, was wirklich los war in der Einsiedelei des heiligen Antonius, gibt es einen einzigen zuverlässigen Augenzeugen. Das ist Athanasius von Alexandrien. Dieser hochgebildete Kirchenlehrer war mit dem berühmten Einsiedler persönlich befreundet. „Πολλακις”, schreibt er, „oftmals” habe er Antonius in seiner Eremitage zwischen Nil und Rotem Meer besucht. Und jedesmal sei er aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen.
Einen Einsiedler stellt man sich nämlich einsam vor. Der heilige Antonius aber war in seiner Einsiedelei alles andere als einsam. In Höhlen, Felsspalten, Erdlöchern und Hütten hausten, rings um Antonius, mehrere tausend Jünger. Ausdrücklich gebraucht Athanasius von Alexandrien in seiner Ortsbeschreibung das Wort „πολις”: eine regelrechte „Stadt von Jüngern” sei entstanden rund um den heiligen Antonius mitten in der Wüste.
Читать дальше