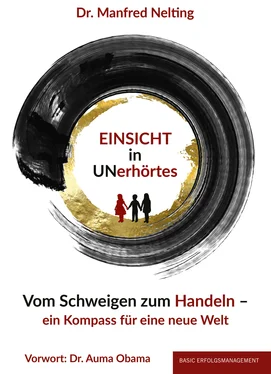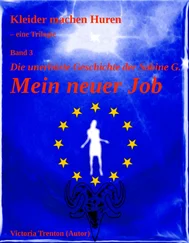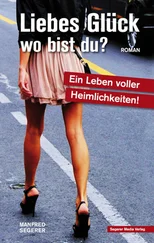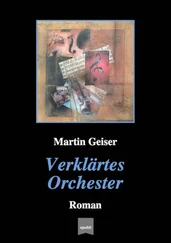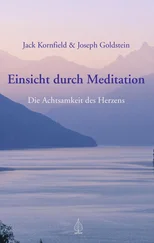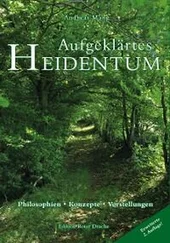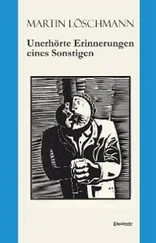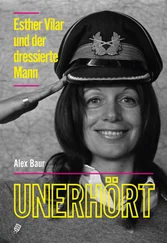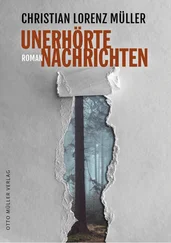Beide Teile, also der untere und der obere präfrontale Kortex, müssen gut angeregt und ausgebildet sein, damit die nächste Herausforderung, nämlich die Selbststeuerung, begonnen werden kann.
Die Anforderungen, auch das Setzen von Grenzen im sozialen Miteinander familiär, ggf. bei der Betreuung durch eine Tagesmutter oder auch in einer Kita, haben jetzt ab dem dritten Lebensjahr in ansteigendem, aber immer angemessenem Maße wichtige Bedeutung. Das Kind beginnt jetzt an Herausforderungen im Spiel oder bei der Rahmensetzung durch die Eltern seine Selbstwirksamkeit und seine aktuellen Grenzen wahrzunehmen und in seiner Impulskontrolle zu wachsen.
Selbststeuerung ist dann ab dem Alter von 3 Jahren, also vom vierten Lebensjahr an eine lebenslange Aufgabe, deren erfolgreiche Bewältigung und lebensgestaltendes Potenzial aber besonders von dem Beginn im vierten und fünften Lebensjahr abhängt. Bei gutem Gelingen in liebevollem, aber auch passend herausforderndem Umfeld bildet der präfrontale Kortex insgesamt seine Selbst-Steuerungsfunktion immer weiter aus und dehnt sie insbesondere auf die Fähigkeit der Wahl, das Planen mit allmählicher Einbeziehung von zeitlich späteren Zielen und der Entwicklung der intrinsischen Motivation (siehe Kapitel 5, Spielen).
Was heißt Selbststeuerung?
Idealtypisch möchte ich das so beschreiben: Ein Kind kann im Laufe des vierten Lebensjahres allmählich immer besser warten, bis seine Impulse erfüllt werden. Die Kinder quengeln und drängeln sicherlich immer wieder, schreien auch mal wütend, aber sie kommen mit dem Warten zunehmend zurecht, ohne dass übermäßiger Stress entsteht. Es bildet sich eine sogenannte Frustrationstoleranz aus, zu der aber die Erfahrung gehört, dass die Bedürfnisse meist später doch befriedigt werden. Vielfach können die Kinder dann schon erkennen, dass das Warten auch Vorteile bringt oder so etwas wie eine erste Vorfreude auftritt.
Das Kind kann dann z. B. beginnen, erste Pläne in der Vorstellung zu machen und das Ganze später ausprobieren. Parallel dazu kann eine erste Umsetzung bereits in der Fantasie und auch im Spiel stattfinden, bevor es dann tatsächlich stattfindet. Beispielsweise kann das Kind erst einmal die Puppe füttern, wenn die Mutter/der Vater das Essen noch nicht fertig hat.
Dazu gehören aber verlässliche Eltern, sonst wird die zeitweilige Frustration zur Bedrückung. Aber verlässliche Eltern können auch „Nein“ sagen, wenn es sinnvoll oder notwendig ist und das Kind kann mit der Klarheit der Eltern, wenn sie sich auch verlässlich auf das „Ja“ erstreckt, gut leben.
Diese Zeit ist an sich märchenhaft, die Kinder leben in einer Märchenwelt, bevor sie dann im sechsten/siebten Lebensjahr von sich aus mehr in die reale Alltagswelt mit ihren Anforderungen eindringen wollen, da unbändige Neugier sie treibt. Dann ist das Gehirn bereit dafür und kann es beginnend fassen.
Bis dahin gilt es, die Kinder immer wieder auch in dieser Märchenwelt zu lassen oder sie auch mit ihnen zu erleben. Für den Alltags-Realismus bleibt noch genug Zeit, man muss ihn in den ersten Jahren nicht überstrapazieren, weil er Kinder in seiner rationalen Erfassungsnotwendigkeit leicht überfordert. Denn Kinder denken noch nicht vernünftig, vielleicht manchmal schon in Ansätzen, aber das macht sie ja auch als Kinder aus und ermöglicht ihnen ihre Eroberung der Welt ohne übergroße Handlungshemmung durch zu viel (kaum zu bewältigende) rationale Abwägung.
Mancher mag glauben, ich übertreibe mit der Ausdehnung der Zeitphasen und sieht für sich und seine Kinder schnellere Phasenabläufe. Aber uns will vieles anders scheinen, wenn noch nicht klar ist, wie es entsteht.
In der Zeit des beginnenden Wahrnehmens eines eigenen, von der Mutter unterscheidbaren „Ichs“ ist es normal, dass das Kind die Möglichkeiten des Ichs ausprobieren will. Dies findet insbesondere im dritten und vierten Lebensjahr, individuell auch später statt.
Nun sind die Kinder sehr verschieden und agieren sehr unterschiedlich in dieser Zeit und in eben ihrer speziellen Familie. Es kommt auch darauf an, wie gut Impulse schon kontrolliert werden können. Manche Kinder sind sehr offensiv und loten die Möglichkeiten und Grenzen sehr offensiv aus, was Eltern manchmal an den Rand ihrer Kräfte, Wirksamkeit und ihrer emotionalen Balance bringen kann, wieder andere machen dies kaum wahrnehmbar für die Eltern. Hier kommt es darauf an, dass Eltern diese Phase ihres Kindes akzeptieren und möglichst auf die Seele des kleinen Kindes passend reagieren lernen.
Das heißt u. a. auch, dass sie zaghaften Kindern gute Räume zum Ausprobieren und offensiven Kindern Räume und gute Grenzen für ihr Ausagieren geben. Unter anderem ist es wichtig, dass man bei den offensiven Kindern sehr darauf achtet, wann sie müde werden, weil sie dann oft noch mal ein Furioso starten und kaum mehr erreichbar sind. In der Folge ist die Gefahr für die Eltern, dass sie das z. B. dann schreiende und sich wehrende Kind auch anschreien und nur mit einer gewaltigen Kraftanstrengung und ggf. einem Ärger auf das Kind (es reagiert nicht mehr, weil es nicht mehr reagieren kann) ins Bett bringen können. Das erleben aber auch die gelassensten Eltern in dieser Phase immer wieder mal.
Im Alltag gibt es für die meist nicht durchgängige Trotzphase keine besten Regeln für Eltern, mal hilft ablenken, mal austoben lassen mit dem Aufpassen, dass das Kind sich nichts tut. Meist ist ein liebevolles Ignorieren, was bedeutet, dass man nicht gegen das Kind kämpft und möglichst wenig Energie in diese Momente gibt, hilfreich zum Auslaufenlassen des Agierens. Insgesamt ist aber die Klarheit der gemeinsamen Regeln beider Eltern wichtig, die das Kind dann allmählich als verbindlich und gesetzt in sein Ich-Kostüm einverleibt.
Wie die Kinder es machen, ist weder gut noch schlecht, sie probieren sich eben aus mit ihren jeweils neu wahrnehmbaren Möglichkeiten in eben dieser speziellen Familie, in die sie hineingeboren sind. Und man sollte Kinder niemals mit anderen vergleichen, sie sind alle so, wie sie sind, unvergleichlich und liebenswert (über das Drama des Vergleichens siehe auch Kapitel 2, S. 116).
1.2.5 Impuls-Unterdrückung beim kleinen Kind
Aufpassen muss man in dieser Phase jedoch mit Regeln, die das notwendige Ausprobieren unterschwellig, aber mit einer für das Kind doch wahrnehmbaren, auf Ärger oder Hilflosigkeit basierenden inneren Härte unterbinden, so dass es zu einer Impuls-Unterdrückung beim Kind kommt, die keine echte hirnphysiologisch wirksam gewachsene Impuls-Kontrolle ist.
Oft unmerklich, nicht stark ausgeprägt, aber mit großer Wirkung durch die tägliche regelmäßige Anforderung stehen viele Kinder z. B. unter
•dressurähnlicher Verhaltens-Konditionierung, ggf. auch aus kulturellen Gründen,
•unterliegen einem Zwang, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, weil schwierige Alltage dies oder jenes erfordern,
•nehmen sich zurück, weil sie Angst bei den Eltern spüren,
•ziehen sich resignierend zurück, weil sie nicht ausreichend Antwort auf ihre kommunikativen Handlungen bzw. keine Anregung für ihre Neugier bekommen,
•oder fühlen sich bedroht durch Liebesentzug bei nicht gewolltem Verhalten oder anderweitiger Strafandrohung usw.
Dann sieht es so aus, als könnten Kinder schon mit drei Jahren perfekt gehorchen, seien gut erzogen oder lernen brav, was die Eltern wünschen. Und die Eltern sind dabei ja in der Regel nicht boshaft oder schlecht, haben es z. B. so von ihren Eltern gelernt, sind darüber hinaus vielfach im Alltag stark belastet oder nicht in eigener Balance. Wir alle unterschätzen dabei aber die Wahrnehmung und innere Wirkung von solchen als nebensächlich eingeschätzten Details und sehen ggf. eher grobe Dinge, dann sogar natürlicherweise eher bei anderen, und bemerken unser eigenes Zutun oft selbst nicht.
Читать дальше