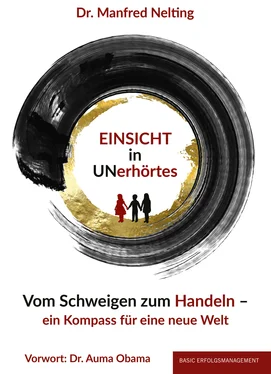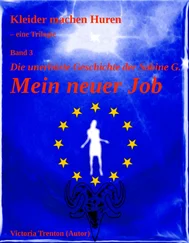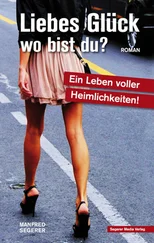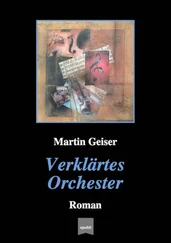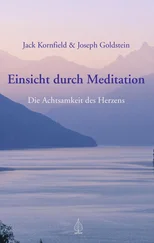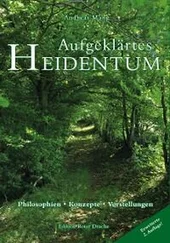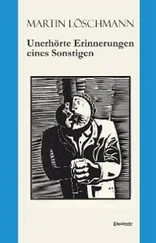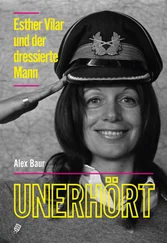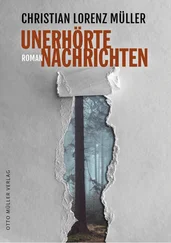1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 Eine zeitweilige Trennung von der Mutter oder Hauptperson setzt keine Schäden, wie wir heute wissen, aber in dieser Zeit ist es auch wichtig, dass eine andere empathiefähige Person da und präsent ist. Trennung ist aber auch etwas, was behutsam gelernt werden muss, weil es im Alltag zwangsläufig immer wieder stattfindet. Dabei lernt das Kind auch, dass die Mutter immer wieder kommt. Es ist dafür besser, wenn die Mutter sich nicht wegschleicht, sondern auf die nun präsente Person verweist und sich kurz verabschiedet. Dabei sollte die „Ersatz“-Person bekannt und vertraut sein und die Trennung im Beginn eben kurz. Später sind dabei auch sogenannte Übergangsobjekte wie ein Schal der Mutter oder ein Stofftier, mit dem gemeinsam gespielt wurde, hilfreich in der Zeit der Trennung. Aber Trennung sollte in der ersten Zeit eben etwas zeitlich sehr Begrenztes sein.
Vorerst in dieser Phasendarstellung gehe ich davon aus, dass die Mutter für ihr Baby einfach da ist.
Unter dieser Kommunikation wächst und reift der untere präfrontale Kortex zur allmählichen und sicheren Wahrnehmung von Ich und Du.
Eine sichere Bindung ist nun Voraussetzung für die nächsten Phasen der Entwicklung der Impulskontrolleund einer später darauf aufbauenden Selbststeuerung(siehe Abb. 2).
Natürlich können und werden weitere Personen im Haushalt wie der Vater oder Partner der Mutter, Geschwister und Großeltern und andere nahestehende Personen die Kommunikation der Mutter mit dem Baby/Kleinkind ergänzen oder kurzphasig ersetzen. Dies ist insbesondere gut möglich, wenn die Stimmen und Gesichter wie beim Vater und Geschwistern, vielleicht auch Großeltern durch Zusammenleben oder häufigen Kontakt schon bekannt sind.
Das Baby wird auch, wenn es wach ist, Zeiten für sich brauchen, in der es seine Hände, Arme und Beine zunehmend kennenlernt und alles um sich herum genau und immer wieder untersucht, wie es sich anfühlt in der Hand und im Mund. Diese Zeiten soll man natürlich nicht stören. Auf die Situation z. B. in Kitas und das Zusammenspiel zwischen Kita bzw. Tagesmutter und Eltern komme ich später.
Die Entwicklung einer sicheren Bindung wird physiologisch begleitet durch die Ausschüttung von Oxytocin, dem Bindungshormon, beim Neugeborenen und bei der Mutter. Dies beginnt bei der Geburt und bekommt einen kräftigen Impuls beim Stillen und ganz besonders beim direkten intensiven Hautkontakt. Dadurch entsteht ein Oxytocin-Level, der im weiteren Leben die Bindungsfähigkeit weiter ausbildet und insbesondere durch körperliche Nähe und Hautkontakt immer wieder angeregt wird, tatsächlich eine verlässliche Ressource im späteren Erwachsenenleben. Übrigens hat der Vater selbst eine gute Bindungsfähigkeit, steigt auch bei ihm der Oxytocin-Level, insbesondere, wenn er auch Hautkontakt mit dem Kind hat.
Die Bedeutung des autonomen vegetativen Nervensystems als weitere zentrale biologische Basis der Bindungsfähigkeit beschreibe ich nach der Phasendarstellung.
Babys, die direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden und ohne sie bzw. ohne konkrete Bezugsperson im Waisenhaus ohne empathische Begleitung aufwuchsen, können später als Kinder und Jugendliche auch bei Aufnahme/Adoption in warmherzige Familien sichere Bindungen schlechter aufbauen sowie weniger Glück aus Begegnungen ziehen. Sie bleiben eher distanziert und misstrauisch. Die Fähigkeit zur Ausschüttung von Oxytocin ist bei ihnen entsprechend deutlich vermindert. Bindungsarbeit, etwa in erlebniszentrierten psychotherapeutischen Gruppen, kann hier auch noch nachträglich moderate Verbesserungen in der Bindungsfähigkeit erzielen .
Das Baby ist in diesen ersten 2 Jahren von Basisimpulsen gesteuert. Es meldet sich lautstark, wenn es Hunger hat, der Stuhlgang drückt, die Haut im Windelbereich gereizt ist oder ein Bedürfnis nach Wärme und konkret spürbarer Umhüllung und Getragenwerden da ist. Auch Schmerzstillung und Trost soll sofort erfolgen. Allen Basisimpulsen ist gemeinsam, dass sie keinen Aufschub dulden. Das Baby schreit eben sonst solange, bis das Bedürfnis gestillt oder das unangenehme Gefühl weg ist.
Einige Eltern meinen, dass ein Kind mit 2 Jahren unartig ist, wenn es wild oder wütend agiert, weil es seinen „Willen“ nicht bekommt. Das ist aber eine Annahme, die aus hirnphysiologischer Sicht grundfalsch ist. Ein Zweijähriges kann noch keine Impulskontrolle haben, weil die sich erst in der Folgezeit im Gehirn strukturell ausbildet.
Daher wirken Bestrafungen in diesem Alter traumatisch, weil das Kind ja nichts anderes machen kann und dadurch in ungeheuren unlösbaren Stress gerät. Stattdessen gilt es, sich feinfühlig in das Kind hineinzuversetzen, damit die „Wut“ des Kindes dann als eigene Kraft im Kind spürbar wird und mit Anregung durch die Eltern für anderes zur Verfügung steht.
Ebenso haben viele Eltern Sorge, dass sie ihr Kind zu sehr verwöhnen, wenn sie in den ersten beiden Jahren immer sehr konkret auf ihre Bedürfnisse eingehen. Auch diese Sorge ist unbegründet, vielmehr wird so die Grundlage gelegt, dass ein Kind später mit seinem vollen Potenzial und Urvertrauen neugierig die Welt erkunden kann. Durch eine Erziehung, die den Kindern schon zu früh das Ertragen von Frustrationen abverlangt, werden die Kinder in ihrer Entwicklung gehemmt und zwar auch ganz konkret auf Gewebeebene mit einem Rückgang der Vernetzung der Hirnzellen untereinander.
Manchmal weinen Babys zur Bewältigung möglicher wiedererinnerter, intrauterin oder durch die Geburt erlittener traumatischer Erfahrungen, wie Pränatal-Experten es ins Spiel bringen. Auch in solchen Fällen, wo es nicht primär um das Stillen von Bedürfnissen geht, gilt es das Baby nicht weinend liegenzulassen, sondern ihm das Weinen auf dem Arm der Mutter oder betreuenden Person zu ermöglichen. Ein Baby regelmäßig länger weinen zu lassen ohne liebevolle Umhüllung (auch in bester Erziehungsabsicht) wirkt in den ersten zwei Lebensjahren meist erneut traumatisch .
Jetzt also erst einmal zurück zur weiteren Gehirnentwicklung im dritten Lebensjahr. Hier entwickelt sich allmählich die Impulskontrolle sowohl körperlicher als auch emotionaler Impulse, die Vorphase zur späteren Selbststeuerung. Was passiert da im Gehirn?
Im dritten Lebensjahr sind die verlässliche, liebevolle Kommunikation und das Da-Sein von Mutter, Vater, Oma oder einer anderen verlässlichen und empathiefähigen Person weiterhin unabdingbar. Der Kommunikationskreis wird dann meist erweitert, aber die sogenannte dyadische Kommunikation wird von der Hauptperson oder beim Zusammenleben auch durch mehrere Personen wie Mutter, Vater und Geschwister weitergeführt und muss auch bei Fremdbetreuung ermöglicht werden.
Auf der Grundlage der sicheren Bindung wird das Kleinkind im Alltag zunehmend herangeführt, dass eine Sofortbefriedigung nicht immer gleich möglich ist, insbesondere bei mehreren Kindern im Haushalt bzw. auch bei z. B. einer Tagesmutter. Aber die Stillung der Bedürfnisse wird nicht lang anhaltend versagt. Für das Gehirn bedeutet das, dass ein Impuls manchmal eine gewisse Zeit aufgehoben werden muss, bevor die Lösung erfolgt. Diese Herausforderung ist ein Reiz für den oberen Anteil des Stirnlappens und dieser wächst darunter ebenfalls großartig und lernt den Impuls eine Weile zu beherbergen, ohne dass das Kind in allzu großen Stress oder Verzweiflung gerät. Dies gelingt aber nur richtig gut, wenn das Kind sich sicher und aufgehoben fühlt.
Diesen Teil des Stirnlappens im Gehirn nennt man den oberen präfrontalen Kortex (siehe Abb. 2auf Seite 60).
Читать дальше