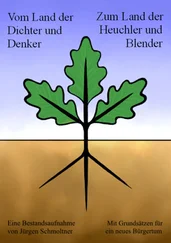Zwei Tage später traf die Hauptstreitmacht ein und Juan erfuhr von Nana, dass das Dorf Talicpacana hieß. Juan ließ Maria das Zelt aufbauen und verstaute die Sachen darin. Sein prüfender Blick wanderte über ihr erschöpftes Aussehen und blieb an den Knöcheln hängen. Die Ketten hatten sie wundgescheuert und verkrustetes Blut mischte sich mit Eiter und offenen Gerinnseln. Er musste etwas tun, oder seine Gefangene wäre bald ein Krüppel. Maria konnte kaum die Füße heben und ließ sich müde auf die Matte fallen. Sie stank nach Schweiß und Blut. Er führte sie zum Fluss, damit sie sich wusch und die Wunden gereinigt wurden. Er dachte, dass die Verletzungen in ein paar Tagen vergehen würden. Es würde einige Tage dauern, ehe sie den Fluss überqueren konnten und bis dahin konnte sie die Füße ruhig halten. Er misstraute ihr gerade jetzt, denn auf der anderen Seite warteten diese Wilden, denen sie sich anschließen konnte. Er überlegte sogar, ob er nicht auch Nana in Ketten legen sollte, aber wahrscheinlich waren seine Füße so schmal, dass sie einfach durchrutschten.
In der Nacht legte er sich zu einer Sklavin und forderte ihren Körper. Sie wimmerte vor Schmerzen und es ärgerte ihn. Die Eingeborenen galten als frivol und freizügig mit ihrem Körper, aber dieses Mädchen hier schien nicht so viel Gefallen daran zu finden. Vielleicht waren es ja nur die Schmerzen? Es würde besser werden, sobald er entschied, ihr die Ketten abzunehmen. Er winkte Nana herein, der in solchen Augenblicken immer draußen warten musste. Der Junge schien es hinzunehmen, ohne weiter darüber nachzudenken. „Hast du Hunger?“, fragte Juan gut gelaunt. Er zog seine Hose hoch und runzelte unwillig die Stirn, als Maria die Beine anzog und sich zusammenrollte.
„Si, Señor!“, antwortete Nana mit leuchtenden Augen.
Juan strich dem Kind über die kurzen Haare. Missbilligend stellte er fest, dass der Junge kaum etwas zum Anziehen hatte, sondern immer noch die gleichen Lumpen wie bei seiner Gefangennahme trug. Das Kind fügte sich besser als die Schwester und er fühlte ein gewisses Wohlwollen. „Sag deiner Schwester, dass sie dir etwas nähen soll!“
Nana schaute ihn mit großen Augen an und versuchte die Worte zu verstehen. „Nähen?“
Juan grinste. „Ja, für dich! Hose und Hemd!“
Nana lächelte und sah an ich herunter. „Hose und Hemd für Nana?“
„Genau! Hose und Hemd für Nana!“ Juan lachte laut, als er feststellte, dass der Junge Fortschritte machte. „Und Essen für Juan, Nana und Maria!“ Das Wort „Essen“ hatte Nana als Allererstes gelernt.
Der Junge rieb sich den Bauch und deutete an, dass er Hunger hatte. „Kein Essen!“, maulte er vorwurfsvoll.
„Aha, ihr habt wohl länger nichts zu essen bekommen“, stellte Juan fest. „Dann komm mal mit. Wir holen das Essen und bringen auch Maria etwas.“
Vertrauensvoll nahm Nana ihn an der Hand und zog ihn mit sich fort. Juan fühlte sich nicht wohl und entzog dem Kind die Hand wieder. Er wollte keine Vertraulichkeiten von einem Untergebenen. Er holte Essen in einem Topf und kehrte in sein Zelt zurück. Er verteilte das Essen auf drei Teller und gab es den Sklaven. Der Junge schaufelte die Suppe gierig in seinen Mund, während Maria teilnahmslos liegenblieb. „Iss!“, befahl Juan verärgert. Wenn sie nichts aß, dann würde er ihr die Nahrung zwangsweise einflößen. Er hatte keine Lust, auf sie zu verzichten. Er gab ihr einen Tritt und beobachtete, wie sie sich langsam in sitzende Position erhob und die Schale in die Hand nahm. „Iss!“, wiederholte er.
Hirschjagd
(Dorf der Menominee)
Der erste Schnee fiel und verbannte die Menschen in die warmen Wigwams. Machwao war froh um die Nahrungsvorräte, die sein Dorf angelegt hatte. Natürlich war es auch möglich, im Winter auf Schneeschuhen zur Jagd zu gehen. Doch dies war mühsam und wurde eher gemacht, um an die wertvollen Pelze zu gelangen. Aus dem Winterpelz der Tiere konnten die Frauen warme Kleidung herstellen. Kein Mann war besonders erpicht darauf, den ganzen Tag auf Schneeschuhen durch die Wildnis zu streifen. Das Wild wurde spärlich und musste mühsam aufgestöbert werden. So saß Machwao lieber am Feuer und schnitzte an neuen Pfeilen oder besserte seine Waffen aus.
Seine Mutter webte aus Halmen und Binsen neue Körbe und Matten, während seine Schwester einen Tontopf mit einem einfachen Muster bemalte. Noch hatte sie ihre ersten Riten nicht durchlaufen und so fanden seine Überlegungen bezüglich eines Ehemanns kein Gehör. Die Mutter schob diese Gedanken weit von sich und lächelte stets, wenn er auf seine Schwester zu sprechen kam. Nepewin Nuki war selbst in sehr jungen Jahren einem Mann als Ehemann versprochen worden und hoffte für ihre Tochter auf eine ebenso sichere Zukunft. Sie war glücklich gewesen, denn ihr Ehemann war gut zu ihr gewesen. Ihre Eltern hatten eine gute Wahl getroffen. Trotzdem hoffte sie, dass die Tochter noch eine Weile in ihrem Haushalt verblieb. Sie sah es als gutes Zeichen, dass die Tochter bisher noch nicht ihre ersten Riten gehabt hatte. So galt sie als Kind. All die Gespräche um einen möglichen Ehemann waren also nur Geplapper. Und ganz sicher würde sie nicht mit einem Schwiegersohn namens „Wakoh“ einverstanden sein! Er war ihr viel zu kämpferisch und verantwortungslos. Machwao dagegen sah seine anderen Qualitäten. „Siehst du nicht, dass er ein guter Jäger ist, der seine Familie stets ernähren kann? Hinzu kommt, dass er wirklich ein tapferer Kämpfer ist, der seine Familie immer beschützen würde!“
Die Mutter schüttelte energisch den Kopf. „Er ist eigennützig. Er sieht nur den eigenen Erfolg. Niemals könnte er sich zum Wohle einer Frau zurücknehmen!“
Machwao wurde ungewohnt wütend. „Er würde für sie sterben. So ist das! Ich habe es gesehen. Ich habe es erlebt. Als wir gegen die Feinde gekämpft haben, wäre er für uns gestorben!“
Die Mutter senkte verunsichert den Kopf. „Ja, aber das heißt nicht, dass er auch ein guter Ehemann wäre. Er ist viel zu unüberlegt.“
Kämenaw Nuki, die kleine Schwester, mischte sich auf gänzlich ungewohnte Weise ein. „Noch bin ich nur ein Kind. Aber eines Tages werde ich einen Mann erwählen. Und jede Frau könnte sich glücklich schätzen, Wakoh an ihrer Seite zu wissen.“ Ihre Augen funkelten verliebt, als sie Machwao verschwörerisch zublinzelte. Machwao war sprachlos und schenkte seiner Schwester einen verblüfften Blick. Die Mutter dagegen schalt ihre Tochter: „Wie kannst du so etwas sagen? Was weißt du schon von Männern? Sei still und überlege dir das nächste Mal, was du sagst!“
Kämenaw Nuki senkte schweigend den Kopf und doch konnte Machwao fühlen, dass sie ihre Meinung nicht ändern würde. Sie bewunderte Wakoh! Und tatsächlich hatte sie recht. Wakoh war schon als Kind von den Donnergeistern auserwählt worden. Seine Eltern hatten ihn früh mit den Dingen des Krieges beschenkt und dafür gesorgt, dass er bestens mit Pfeil und Bogen vertraut war. Schon als kleiner Junge hatte er von den Donnervögeln geträumt und in seinem Kriegsbündel befanden sich eine winzige Kriegskeule, ein kleiner Bogen mit winzigen Pfeilen und die donnernden runden Steine. Machwao wusste von einigen Dingen, aber er wusste auch, dass Wakoh inzwischen weitere Glücksbringer erhalten hatte. Seine Schutzgeister waren mächtig.
Machwao grinste und wechselte dann das Thema. Es war nicht gut, die Mutter auf falsche Gedanken zu bringen. „Morgen werden wir zur Jagd aufbrechen und ich werde Awässeh-neskas begleiten. Wir wollen Biber fangen.“
„Geht es ihm wieder gut?“, erkundigte sich die Mutter.
„Aber ja. Ich sorge dafür, dass er schnell wieder seine Familie versorgen kann. Es wird Zeit!“
„Oh, das ist schön. Es hat lange gedauert!“ Die Mutter lächelte. Machwao schwieg, als er an den Freund dachte. Ja, Awässeh-neskas hatte wirklich mit dem Tod gerungen, doch nun ging es ihm wieder besser. Er wartete auf die Geburt seines ersten Kindes und ein bisschen Abwechslung würde ihm die Kraft zurückgeben. Der Schnee lag hoch, hatte das Land fest in seinen eisigen Klauen und die Jagd mit Schneeschuhen würde ihn auf andere Gedanken bringen.
Читать дальше