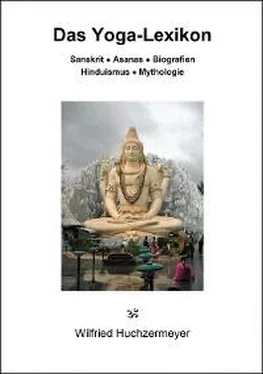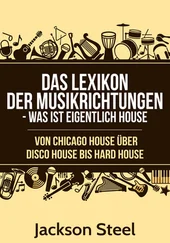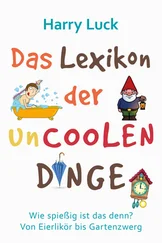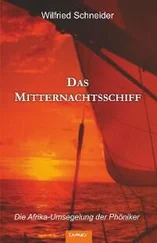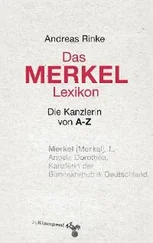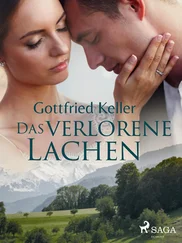1 ...6 7 8 10 11 12 ...23 Āsana n Sitz; Matte; Körperhaltung. Die Grundbedeutung leitet sich ab von der Wurzel ās, sitzen. Ursprünglich bezeichnete das Wort die besondere Fläche, auf welcher der Yoga-Übende sitzt. Texte wie die Bhagavadgītā (6.11) führen detailliert aus, wie dieser Untergrund beschaffen sein soll, d.h. nicht zu hoch oder zu tief, sauber und in ruhiger Umgebung. Auch die Art des Sitzes, aus heiligem Gras, Tuch oder Tierfell, wird ausführlich beschrieben.
Die Bedeutung „Yoga-Haltung“ ist die bekannteste. In der Bhagavadgītā 6.13 und im Yogasūtra 2.46 wird das Thema „Körperhaltung“ (während der Meditation) nur sehr kurz angesprochen, aber Schriften wie die Hathapradīpikā oder Gheranda-Samhitā stellen zahlreiche Āsanas im Detail vor.
Einige Texte sagen, Shiva habe ursprünglich 840 000 Haltungen dargelegt, die individuell den verschiedensten Arten von Lebewesen gerecht werden. Aber für den praktischen Gebrauch werden, je nach Quelle, 32 oder auch 84 gängige Āsanas genannt. Aktuelle Yoga-Titel stellen zum Teil weit über 100 vor. Die historisch ältesten Abbildungen von Āsanas wurden auf den Siegeln der Indus Kultur gefunden (siehe auch Hatha-Yoga, vorletzt. Abs.).
Der ursprüngliche Zweck der Haltungen war, den Körper während langer Meditationen zu stabilisieren, wobei z.B. empfohlen wird, Rücken, Hals und Kopf möglichst in gerader Linie zu halten. Ferner sollten Āsanas generell auch die Gesundheit des Übenden stärken. Die so erworbenen Erfahrungen legten die Grundlage für erfolgreiche therapeutische Anwendungen in unserer Zeit.
In Yoga-Schulen werden Āsanas in zahlreichen Übungsstilen unterrichtet. So können die einzelnen Stellungen z.B. eher langsam und meditativ oder zügig, fließend und kraftvoll durchgeführt werden.
Viele Variationen sind auch bei der Anzahl von Āsanas in einer Übungseinheit möglich, ebenso bei der Zusammenstellung von bestimmten Sequenzen, indem die einzelnen Stellungen so aufeinanderfolgen, dass eine optimale Wirkung erzielt wird. Dabei können Sequenzen auch individuell erstellt werden, um den Voraussetzungen und Erfordernissen des Einzelnen zu entsprechen.
Einige Schulen verwenden Hilfsmittel wie Blöcke und Seile und legen großen Wert auf die präzise Durchführung der Āsanas, wobei die Lehrenden persönlich eingreifen und korrigieren. Andere sagen nur die Übungen an und heben mehr den Aspekt der inneren Erfahrung hervor.
So kann auch grundsätzlich die Zielrichtung des Unterrichts variieren, indem die Āsanas in der einen Schule primär als Teil einer spirituellen Praxis verstanden werden, während eine andere vor allem Zwecke wie Fitness und Therapie verfolgt.
Ein wichtiger Aspekt der Āsanas ist ihr Einfluss auf den feinstofflichen Körper, d.h. die Nādīs und Cakras, deren Energieströme gezielt gelenkt werden. Eine entsprechende Übungspraxis ist in der Regel nicht Teil des populären Yoga-Unterrichts, wird aber von einigen Yoga-Zentren als Teil ihres Programms angeboten.
Einige bekannte Übungsstile sind Anusara-Yoga, Ashtānga-Vinyāsa-Yoga, Iyengar-Yoga, Pilates-Yoga, Sivananda-Yoga, Viniyoga, Yesudian-Yoga.
Siehe auch Hatha-Yoga.
Asat n das Nicht-Sein (a-sat). Bezeichnet den unbeschreiblichen und unerkennbaren Urgrund des Seins, aber auch das Un-Wirkliche, welches nicht echtes Sein ist.
Ein bekanntes Gebet in den Upanishaden, beginnt mit den Worten: asato mā sad gamaya – vom Nichtsein führe mich zum Sein.
In der Schöpfungshymne in Rigveda 10.129.1-2 heißt es: „Seiendes war nicht, noch Nichtsein. Nicht Erde oder Luftraum oder Himmelsgewölbe... Ewig waltete das Ureine ohne Atem, und außer Ihm war nichts im weiten Kosmos.“
Siehe auch Sat.
Āshādha [āṣāḍha] m Name des vierten Monats im Hindu-Kalender (Juni/Juli).
Āshaya [āśaya] m Ruhestätte, Sitz, Platz, Behältnis. In der Yoga-Philosophie die Ansammlung von Früchten früherer Handlungen, auch Karma-Āshaya („Handlungsdepot“) genannt. Diese reifen in den unterbewussten Schichten des Menschen und beeinflussen seine Geburt, Lebensdauer und Lebenserfahrung.
Siehe auch Samskāra.
Ashoka (1) [aśoka] m od adj wörtl. “ohne Sorge”, a-shoka. Name eines stets grünen heiligen Baumes (Saraca indica). Dessen rote Blüten dienen, zu Girlanden gebunden, der Verehrung des Liebesgottes. Der Rinde des Baumes werden im Āyurveda Heilwirkungen zugeschrieben.
Ashoka (2) [aśoka] m Name eines berühmten Königs, der im 3. Jh. v.Chr. in Nordindien lebte (272 – ca. 231). Eine tiefe innere Krise nach einem blutigen Feldzug bewirkte seinen Übertritt zum Buddhismus, dessen Verbreitung er nach Kräften förderte.
Āshrama (1) [āśrama] m oder n Einsiedelei; Mönchszelle; religiöses oder spirituelles Zentrum, Ashram. Von der Wurzel śram, sich anstrengen, denn dies ist ein Ort, wo sich Schüler unter Anweisung eines Lehrers um Fortschritt bemühen. In Indien tragen viele große Yoga-Zentren diese Bezeichnung.
Āshrama (2) [āśrama] m in den vedischen Schriften Bezeichnung für die vier klassischen Lebensstadien des Menschen: Brahmacarya, die Zeit des Lernens als Schüler; Grihastha, das Stadium des Familienvaters und Haushälters, der seine entsprechenden Pflichten erfüllt; Vānaprastha, die spirituelle Suche in der Einsamkeit; und Samnyāsa, Entsagung aller gesellschaftlichen Bindungen und ausschließliches Streben nach Moksha, spiritueller Befreiung.
Ashtādhyāyī [aṣṭādhyāyī] f die bekannte Sanskrit-Grammatik des Pānini, wörtl. „Jene, welche acht Kapitel hat“. Pānini vermochte es, die zahlreichen, teils komplizierten Regeln der Sanskrit-Grammatik in äußerst knappe Formeln zu fassen, wofür er sich eine eigene Kürzel-Sprache schuf.
Ashtānga-Yoga [aṣṭāṅgayoga] m der Yoga der acht (aṣṭa) Glieder (aṅga). Der aus acht Stufen bestehende Yoga-Weg des Patañjali: Yama, Niyama, Āsana, Prānāyāma, Pratyāhāra, Dhāranā, Dhyāna, Samādhi.
Siehe ausführliche Erläuterungen unter diesen Sanskrit-Begriffen und eine zusammenfassende Darstellung unter Rāja-Yoga.
Ashtānga-(Vinyāsa-)Yoga m Bezeichnung für ein Körperarbeitssystem, das insbesondere K. Pattabhi Jois, ein Schüler von Krishnamacharya, im südindischen Mysore etwickelt hat. Das Übungssystem besteht aus sechs Serien von Āsanas, die jeweils einem bestimmten Muster folgen, indem die energetische Intensität ständig zunimmt, einen Höhepunkt erreicht, dann wieder abflacht und in tiefer Entspannung endet.
Die einzelnen Āsanas sind durch Bewegungselemente mit synchronisierter Atmung verbunden (Vinyāsa heißt „Bewegung, Stellung; Verbinden“) und werden dynamisch durchgeführt, wobei auf eine korrekte, gesundheitsfördernde Ausrichtung der Gelenke Wert gelegt wird.
Die Übungen erzeugen eine große innere Hitze, die die Muskeln geschmeidig werden lässt und das Nervensystem reinigt, während die Körperzellen reichlich Sauerstoff und Energie erhalten. So soll der Körper stark und flexibel werden und der Geist ruhig und konzentriert. Als sehr wichtig wird die bewusste Wahrnehmung des Atems während der Übungsfolgen bezeichnet.
Ashtāvakra [aṣṭāvakra] m Name eines bekannten Weisen, der ein Lehrer Patañjalis war. Aufgrund eines Fluches seines Vaters trug er acht (aṣṭā) körperliche Missbildungen (vakra), von denen er jedoch später durch den Segen seines Vaters wieder befreit wurde. Aṣṭāvakra lehrte einen reinen Jñāna-Yoga oder Weg der Erkenntnis.
Ashtāvakrāsana n die Ashtāvakra-Haltung.
aṣṭāvakra – Eigenname (s.o.); āsana – Haltung.
Ashva [aśva] m Pferd. Als Ur-Pferd gilt in der indischen Mythologie Uccaihshravas, welches beim Quirlen des Milchozeans hervortrat. Indra eignete sich dieses göttliche, weiße Pferd an und stutzte ihm seine Flügel, damit es auf Erden bliebe.
Читать дальше