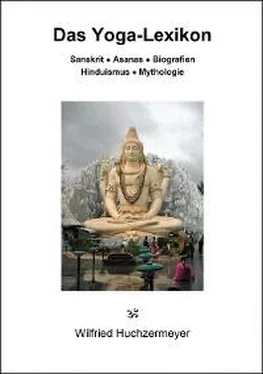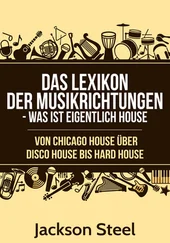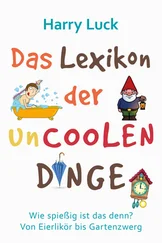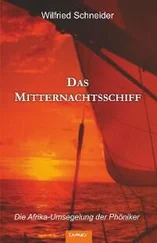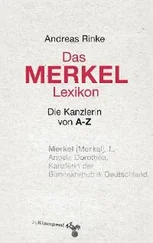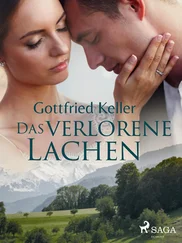Die Apsaras leben in Indras Himmel und sind die Gefährtinnen der Gandharvas.
Āptakāma m ein Mensch, dem alle Wünsche (kāma) erfüllt sind und der daher spirituell befreit ist, weil er kein Begehren mehr hat.
Apunya [apuṇya] adj und n unrein. Fehler, Verfehlung, Nicht-Punya.
Ārambhāvasthā f der Zustand (avasthā) des Anfangs (ārambha). Das erste von vier Stadien in der Entwicklung eines Yogīs, gemäß der Hatha-Pradīpikā verbunden mit dem Hören von mystischen Klängen und dem Durchtrennen des Brahma-Granthi.
Andere Quellen nennen als Merkmale dieses Stadiums das Rezitieren von Om oder die Reinigung der Nādīs.
Siehe auch Avasthā.
Āranyaka [āraṇyaka] n (Abhandlung) „den Wald betreffend“. Gattung vedischer Schriften, die sich an die Brāhmanas anschließen und für die Lektüre von Einsiedlern im Wald (aranya) bestimmt sind.
Āratī f abendliche Anbetung mit Blumen, Räucherstäbchen und einer Kampferflamme, welche kreisförmig um ein Götterbild geschwenkt wird. Dabei hat der Kampher eine symbolische Bedeutung: so wie er ohne Rückstände verbrennt, verzehrt die Flamme von Gottes Liebe das menschliche Ego.
Arcanā f Verehrung des Göttlichen durch verschiedene Rituale.
Architektur die Wissenschaft von der Baukunst existiert in Indien bereits seit alter Zeit unter den Namen Sthāpatya-Veda, Vāstu-Jñāna und Vāstu-Vidyā und zählt zu den Upavedas oder sekundären Vedas. Offenbart wurde sie nach alter Lehre den Menschen von Vishvakarman, dem göttlichen Ur-Architekten.
Dieses Wissen wurde von zahllosen Baumeister- und Handwerker-Generationen zunächst mündlich überliefert, bevor es ab ca. dem 4. Jh. auch schriftlich fixiert wurde.
Die Texte beschäftigen sich mit allen äußeren ebenso wie den esoterischen Aspekten insbesondere des Tempelbaus. So geht es nicht nur um das rechte Material und die rechte Farbe für den jeweiligen Bau, sondern auch um die Kunst der optimalen Anordnung von Räumen, wobei dem Feng-Shui verwandte Überlegungen eine Rolle spielen. Auch das fachkundig durchgeführte Ritual der Einweihung unter Berücksichtigung astrologischer Konstellationen ist von Bedeutung.
Während nordindische Tempel in der Regel nur eine begrenzte Größe aufweisen, wurden in Südindien teils riesige großflächige Anlagen errichtet.
Siehe auch Kunst.
Ardha halb, halbe, halber etc., ein Wortelement in Āsana-Bezeichnungen.
Ardhacandrāsana n Halbmond-Haltung.
ardha – halb; candra – Mond; āsana – Haltung.
Ardhamandalāsana n Halbkreis-Haltung.
ardha – halb; maṇḍala – Kreis; āsana – Haltung.
Ardhamatsyendrāsana n die halbe Matsyendra-Haltung; der halbe Drehsitz.
ardha – halb; matsyendra – Name eines Yoga-Meisters (Matsyendra); āsana – Haltung.
Ardhanārīshvara m der Gott Shiva als androgynes Wesen in halb männlicher und halb weiblicher Form, wodurch die transzendente Einheit von Shiva und Shakti symbolisiert wird.
ardha – halb; nārī - Frau; īśvara – Herr.
„Arische Einwanderung“ siehe Indoarische Migration.
Arishta [ariṣṭa] n Vorzeichen, Omen. Aufgrund der Vernetzung von Mikro- und Makrokosmos können bestimmte äußere Ereignisse als spirituell relevant gedeutet werden. So wurde z.B. von vielen Beobachtern ein ungewöhnlicher Lichtschweif am Himmel gesichtet, als Ramana Maharshi seinen Körper verließ.
Ārjava n Aufrichtigkeit, wird u.a. in der Bhagavadgītā als positive Eigenschaft des Yoga-Aspiranten genannt.
Arjuna, Ardschuna m im Mahābhārata einer der fünf Pāndava-Brüder und mächtiger Kämpfer. In der Bhagavadgītā, die Teil des Mahābhārata ist, tritt er als Schüler und Gesprächspartner Krishnas auf und empfängt von ihm dessen spirituelle Lehren in einem Augenblick großer persönlicher Niedergeschlagenheit. „arjuna“ bedeutet weiß, hell, rein. Siehe auch Pāndu.
Ārogya n Gesundheit. Im Hatha-Yoga kann dieser Begriff im Sinne einer Befähigung für bestimmte Praktiken wie z.B. Atemregulierung erweitert werden.
Ārohanāsana n die Hebestellung.
ārohaṇa – Anheben (der gestreckten Beine); āsana – Haltung.
Artha m Ding, Objekt; Reichtum, Wohlstand, Besitz; Ziel, Zweck. Das Wort bezeichnet auch speziell eines der vier Ziele menschlichen Strebens (Purushārtha), d.h. das Erwerben materiellen Wohlstands in der ersten Lebensstufe.
Arthashāstra [arthaśāstra] n Abhandlung über den (politischen) Nutzen, Lehrbuch der Staatskunst, gemäß der Überlieferung verfasst von Kautilya, auch Cānakya genannt. Allerdings vermutet die Forschung, dass es sich tatsächlich um eine Kompilation handelt, an der mehrere Autoren beteiligt sind.
Inhaltlich geht es in 15 Abschnitten um alle Fragen der Staatskunst und Regierung, die Ausbildung des Herrschers und seine Pflichten.
Aruna [aruṇa] m vedischer Gott der Morgenröte; Morgenröte; Kutscher der Sonne, Sūrya.
Arunāchala [aruṇācala] m ein heiliger Berg im südindischen Tamil Nadu, der nach örtlicher Legende älter als der Himālaya sein soll. Bekannt wurde der kleine Berg durch Ramana Maharshi, der viele Jahre in dessen Höhlen meditierte und später seinen Ashram in der Nähe begründete. An seinem Fuß befindet sich auch der riesige Arunāchaleshvara-Tempel.
Die wörtliche Bedeutung ist rötlicher (aruṇa) Berg (acala). aruṇa bedeutet auch Sonne, Morgenröte.
Arunāchaleshvara-Tempel siehe Tiruvannāmalai.
Arundhatī f die Frau des Sehers Vasishtha, sie gilt den Hindus als ideale Ehefrau.
Ārya adj und m das Wort bedeutet in seiner Grundbedeutung „edel“ und wurde in der vedischen Zeit für aufrichtige spirituelle Sucher verwandt, während unaufrichtige oder nicht fähige „anārya“ waren. Es stand auch allgemein für Menschen, die aufstreben, sich um etwas bemühen.
Das Wort erhielt erst auf der Grundlage von Interpretationen einiger westlicher Gelehrter die Bedeutung „Arier“ im Sinne eines überlegenen Volkes.
Siehe auch Indoarische Migration.
Aryaman m Name eines Āditya, einer vedischen Gottheit, die oft zusammen mit Mitra und Varuna angerufen wird. Aryaman steht für die Kraft des Opfers, die nach Wahrheit strebende Aktion.
Ārya Samāj m arische oder edle Gesellschaft. Eine Vereinigung, die 1875 von Svami Dayananda Sarasvati gegründet wurde, um die alte und ursprüngliche vedische Tradition neu zu beleben und zu bekräftigen. Teil der Arbeit der Gesellschaft war es, der Konvertierung von Hindus in andere Religionen entgegenzuwirken und diese, wenn möglich, rückgängig zu machen.
Die Zuwendung auch zu den Angehörigen niederer Kasten und Kastenlosen fand keine Akzeptanz in höheren Gesellschaftsschichten, so dass die Bewegung in Indien nur begrenzte Wirkung entfalten konnte.
Der Ārya Samāj fand zum Teil auch im Ausland unter Bürgern indischer Abstammung Anklang und unterhält heute weltweit zahlreiche Zentren, welche vor allem soziale und philanthropische Aktivitäten koordinieren.
Siehe auch Dayananda Sarasvati, Svami.
Asamprajñāta-Samādhi [asaṁprajñāta] m die zweite und höchste Stufe des Samādhi. Bei der ersten (samprajñāta – bewusst) wird der Geist des Meditierenden eins mit dem Gegenstand der Konzentration, aber es existiert beim Individuum noch das Bewusstsein eines Objekts.
Beim asamprajñāta (nicht-bewusst, überbewusst) wird auch diese Vorstellung eines Objektes gelöscht. Wenn man lange in diesem absoluten Zustand verharrt, werden die Samskāras, die unterbewussten Wünsche, Impressionen etc. aufgelöst, die bei der ersten Stufe zwar unter Kontrolle sind, aber noch weiter im Keim bestehen bleiben. So bewirkt dieser Samādhi die Loslösung von allen Karma-Ketten und führt zur spirituellen Befreiung.
Er wird auch Nirbīja-Samādhi genannt („ohne Keim“), im Vedānta Nirvikalpa-Samādhi („ohne Differenzierung“ von Subjekt und Objekt).
Читать дальше