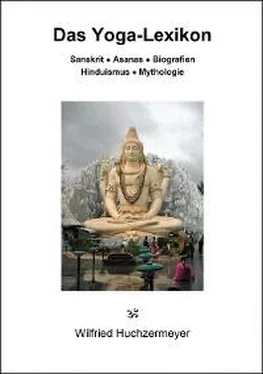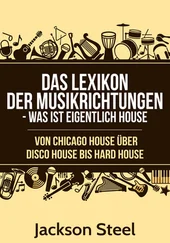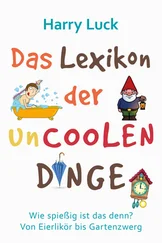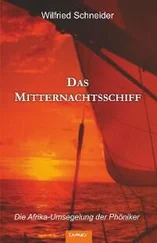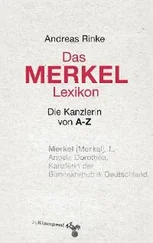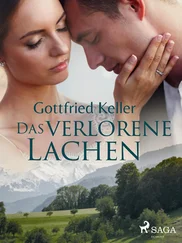Einst verliebte sich Ushā, die Tochter des Asura-Königs Bāna in Aniruddha und brachte ihn durch ihre okkulten Kräfte in ihre Gemächer. Als der König ihn aber durch seine Wächter gefangensetzen wollte, wehrte er sich und besiegte sie mit seiner eisernen Keule. Daraufhin machte Bāna von seinen Zauberkräften Gebrauch und hielt Aniruddha fest, bis schließlich Krishna, Balarāma und Pradyumna ihn befreiten.
Aufgrund einer Intervention Shivas wurde Bānas Leben jedoch verschont. Aniruddha und Ushā heirateten und begaben sich in die Heimat Aniruddhas, nach Dvāraka.
Anirvacanīya adj unsagbar, nicht mit Worten auszudrücken.
Añjali-Mudrā f Zusammenlegen der Hände auf Herzhöhe, um zu grüßen bzw. Ehrerbietung zu erweisen. Auch im modernen Hinduismus weit verbreitet.
Añjaneya m ein Name Hanumāns, abgeleitet vom Namen seiner Mutter, Añjanā.
Āñjaneyāsana n die Āñjaneya-Haltung; Halbmond; Mond.
Āñjaneya – Eigenname, Name Hanumāns; āsana – Haltung.
Ankusha [aṅkuśa] m od n Elefantenstachel; auch ein (glückverheißendes) Attribut Indras, Ganeshas und anderer Gottheiten.
Annamaya-Kosha [kośa] m die gröbste der fünf Hüllen, die das höchste Selbst umgeben, „aus Nahrung bestehend“ (anna-maya), d.h. der physische Körper.
Siehe auch Kosha.
Annapūrnā [annapūrṇā] f wörtl. diejenige, die voller Nahrung (anna) ist, d.h. die „Mutter der Fülle“, ein Name der Göttin Durgā oder Pārvatī. Sie wird mit einem Reistopf in den Händen dargestellt.
Antahkarana [antaḥ-karaṇa] n das „innere Instrument“, bezeichnet im Sānkhya das geistige Organ des Menschen, bestehend aus Buddhi, Ahamkāra und Manas.
Antakāla m die Zeit (kāla) des Endes (anta), die Todesstunde. Krishna erklärt in der Bhagavadgītā 8.5.: „Und wer in der Stunde des Todes, beim Verlassen des Körpers, an Mich allein denkt, der gelangt ohne Zweifel zu meinem Wesen.“
Antaka m ein Name des Todesgottes Yama, wörtl. der „Beender“.
Antarakumbhaka m oder n das Anhalten des Atems (kumbhaka) nach voller Einatmung (antara bedeutet innen, innerlich).
Antarāla n kleine Vorhalle zum Allerheiligsten eines Tempels.
Antaranga n der innere (antar) Teil (aṅga), bezeichnet im Yogasūtra die letzten drei der acht Stufen des Yoga.
Siehe auch Bahiranga und Ashtānga-Yoga.
Antarātman m das innere Selbst, der höchste Geist, der im Menschen wohnt.
Antarāya m ein Hindernis auf dem Weg des Yoga, wie z.B. Trägheit, Zerstreuung oder Begierde etc.
Antariksha [antarikṣa] n der „Zwischen-Raum“, d.h. der Bereich zwischen Erde und Himmel, die Sphäre der Gandharvas und Apsaras.
Antaryāmin m der innere Lenker, das Göttliche als innewohnende Gegenwart im Menschen.
Anugītā f ein Abschnitt im 14. Buch des Mahābhārata (14.16-51), mit Unterweisungen Krishnas für Arjuna. Dabei werden Themen wie die spirituelle Befreiung, Seelenwanderung, die Gunas u.a. erörtert.
Anugraha m Gunst, göttliche Gnade, die dem aufrichtigen Yogī zuteil wird.
Anukramani [anukramaṇī] f Tabelle, Liste. Textgattung, die für die vedischen Hymnen das erste Wort jeder Hymne, die Anzahl der Verse, den Namen und die Familie der Rishis sowie die Metren und Gottheiten benennt.
Anuloma-Prānāyāma [prāṇāyāma] m eine Atemübung, bei der durch beide Nasenlöcher eingeatmet und wechselweise durch je ein Nasenloch ausgeatmet wird.
Anuloma bedeutet „mit dem Strom, natürlich“.
Anumāna n in der Philosophie eine Schlussfolgerung aufgrund bestimmter Voraussetzungen.
Anurāga m Liebe, Hingabe.
Anushthāna [anuṣṭhāna] n Ausführung, Praxis. Die systematische Durchführung religiöser Praktiken über einen längeren Zeitraum.
Anushtubh [anuṣṭubh] f Name eines Versmaßes, das 4 x 8 Silben enthält.
Anusara Yoga m Yoga-Stil, der 1997 von dem Amerikaner John Friend begründet wurde. Das Wort anusāra bedeutet im Sanskrit „Folgen, Nachfolgen“ oder „natürlicher Zustand“ und wird hier frei übersetzt als „following one’s heart“, dem eigenen Herzen folgen, oder „flowing with grace“, mit der Gnade fließen. Ziel ist eine freudige Yogapraxis, die den Schülern hilft, „im Einklang mit dem Körper die innere Schönheit zu erleben.“
Fünf generelle Prinzipien der Ausrichtung (alignment) sollen den Übenden helfen, zu ihrer immanenten idealen Körperhaltung zurückzufinden und den Energiefluss im Körper zu verbessern. Aber nicht die Perfektion bei der Ausführung von Āsanas steht im Mittelpunkt, sondern die natürliche Freude, mit der sie ausgeführt und als Teil der persönlichen Entwicklung erlebt werden
John Friend verfügte über langjährige Erfahrung als Iyengar-Yoga-Lehrer und studierte intensiv das Tantra, bevor er sein eigenes System entwickelte, in das Elemente des Tantra einflossen. Yoga bedeutet für ihn, das Göttliche, das in allen Menschen präsent ist, zu erkennen und zu erwecken.
Meditieren, Chanten und das Studium heiliger Schriften sind Teil des umfangreichen Programms, das auch therapeutische Anwendungen beinhaltet.
Ānvīkshikī [ānvīkṣikī] f Logik, Philosophie, Metaphysik. Mit ihrer Hilfe wird die Erkenntnis dessen, was wahres Selbst und Nicht-Selbst ist, erarbeitet.
Āpah [āpaḥ] f (Plural von ap) Wasser. Eines der fünf Elemente, die die physische Natur konstituieren. Die anderen sind Erde, Feuer, Wind, Äther.
Siehe auch Pañcabhūta.
Apāna m wörtl. Herab-Atem oder -Energie (apa-āna). Einer der fünf Ströme des Prāna, wird im unteren Bereich des Körpers lokalisiert und reguliert Ausatmung und Ausscheidung.
Apānāsana n die Apāna-Haltung; Dehnung des unteren Rückens; Kniee zur Brust.
apāna – Apāna (s.o.); āsana - Haltung.
Aparā Prakriti [prakṛti] f die niedere Natur, die Welt des Stofflichen. Siehe auch Prakriti.
Apara-Vidyā f das niedere Wissen, die relative, indirekte Erkenntnis, die durch den Intellekt und die Sinne erlangt wird. Dagegen ist Para-Vidyā die direkte, absolute Erkenntnis des Brahman.
Aparigraha m Nicht-Ergreifen, Besitzlosigkeit, Freiheit von Habgier. Eine der fünf ethischen Leitlinien in der ersten Stufe des Rāja-Yoga. Siehe auch Yama.
Aparnā [aparṇā] die „Blattlose“, ein Name der Tochter Himavats. Einmal ging sie in eine so intensive innere Versenkung, dass sie nicht einmal ein Blatt zu sich nahm. Sie ist identisch mit Shivas Gattin Umā.
Āpastamba, Āpastambha m Name eines Rishis, der eine bedeutende vedische Schule begründete, in der unter anderem das Āpastambashrautasūtra entstand, ein Handbuch der Rituale.
Apavāda m in der Philosophie die Zurückweisung oder Widerlegung einer falschen Meinung.
Apavarga m spirituelle Befreiung, ein Synonym für Begriffe wie Moksha oder Kaivalya. Von apa-vṛj – abbiegen, verlassen (weltliche Geburten).
Appār [wörtl. Vater, Tamil] Name des südindischen Heiligen Tirunavukarasar, der im 7. Jh. lebte und einer der bedeutendsten Nayanmars war. Er verfasste zahlreiche an Shiva gerichtete Lieder und Gedichte.
Es wird berichtet, dass Appar zunächst Jaina war und dann zum Shivaiten konvertierte, nachdem er in einem Shiva-Tempel die wundersame Genesung von einer schweren Krankheit erfuhr. Er bekehrte später viele andere Menschen zum Shivaismus, so auch den jainistischen Pallava-Herrscher Mahendra, der ihn einmal gefangen setzen und schwer misshandeln ließ. Doch als der Heilige anschließend wie unversehrt Shiva lobpries, war Mahendra so beeindruckt, dass er an Stelle des Jaina-Klosters in der Hauptstadt einen Shiva-Tempel errichtete.
Apsarā f himmlische Nymphe, Wesen von überirdischer Schönheit. Apsarās treten bisweilen als Verführerinnen von Yogīs auf, wenn diese durch überehrgeizige Askese sich selbst oder die Welt aus dem Lot zu bringen drohen, oder wenn es deren Bestimmng ist, zum Vater eines Kindes zu werden.
Читать дальше