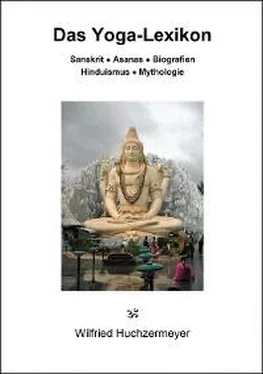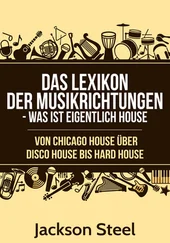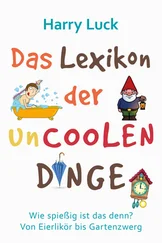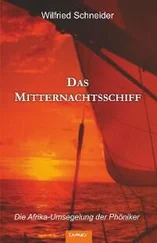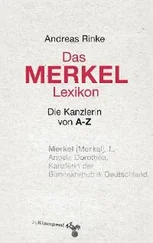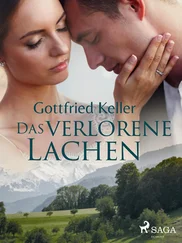Desaerschiedene Institutionen zur Förderung des Yoga und der ganzheitlichen Gesundheit und bildete einige hundert Yoga-LehrerInnen aus. 1994 musste er aufgrund Fehlverhaltens gegenüber einigen Schülerinnen die von ihm gegründete Gemeinschaft verlassen und lebte zunächst zurückgezogen.
Doch nach einigen Jahren wurde er wieder als Yoga-Lehrer tätig und leitet zur Zeit das Amrit Yoga Center in Salt Springs, Florida.
Desha [deśa] m Ort, Platz, Land. Der Ort, wo der Yogī seine Meditation und Übungen durchführt. Zum Teil werden detaillierte Empfehlungen für das äußere Umfeld gegeben. So sollte es rein sein und eine angenehme Atmosphäre aufweisen. Viele Yogīs ziehen sich zur Meditation gern in die Berge, eine Höhle oder einen abgelegenen Tempel zurück.
Desikachar, T.K.V. [deśikācār] bedeutender indischer Yoga-Lehrer (geb. 1938), Schüler und Sohn des bekannten Yoga-Meisters Krishnamacharya, entwickelte maßgeblich den Viniyoga.
Deva m Gott, persönliche Gottheit, Bewohner der Himmelsregionen.
Gemäß dem Rigveda gibt es insgesamt 33 Götter und Göttinnen, davon je 11 im Himmel, auf der Erde und im Wasser. Einige gemeinsame Merksmale sind, dass sie in leuchtenden Wagen fahren, keinen Schlaf benötigen und „Soma“ trinken.
Im Mahābhārata (1.1) heißt es, es gebe 33 333 Götter. Diese unendliche Vielzahl von Göttern ist charakteristisch für den Hinduismus. Tatsächlich handelt es sich für die meisten Hindus jedoch nur um verschiedene Antlitze des Einen Gottes, der in verschiedenen Formen verehrt wird. So heißt es schon im Rigveda (1.164.46), „Das Eine Seiende benennen die Weisen auf vielfältige Weise.“
In der Geschichte von Nala und Damayantī im Mahābhārata werden als Merkmale der Götter u.a. genannt, dass sie nicht schwitzen, blinzeln, keinen Schatten werfen und mit den Füßen nicht den Boden berühren. Sie sind ewig jung und leben unvorstellbar lang.
Zu den populärsten Göttern in Indien zählen Krishna und Rāma (als Inkarnationen Vishnus) sowie Shiva und Ganesha. Bekannte weibliche Gottheiten sind z.B. Durgā, Lakshmī oder Sarasvatī.
Über den Ursprung der Götter heißt es im Mahābhārata, dass die Söhne von Kashyapa und Aditi zu den Ādityas, den Sonnengöttern, wurden, die Söhne von ihm und Diti dagegen zu den Daityas, den Asuras.
Devadāsī f wörtl. „Gottesdienerin“; Tempeltänzerin, die einer Gottheit angetraut wird. Schon in jungem Alter wurden im traditionellen Indien – die Sitte wurde 1947 verboten – Mädchen von ihren Eltern in einen Tempel gebracht, aus religiösen Motiven oder aufgrund von Armut.
Die Mädchen mussten im Tempel verschiedene rituelle Arbeiten verrichten, tanzen, singen und auch als Prostituierte zur Verfügung stehen, erlangten jedoch trotz dieser letzteren, aufgezwungenen Tätigkeit in der Gesellschaft oft einen geachteten sozialen Status.
Devadatta m wörtl. Gott-gegeben (deva-datta). Einer der fünf sekundären Lebenshauche, wird mit der Funktion des Gähnens in Verbindung gebracht, das zusätzliche Sauerstoffaufnahme bewirkt.
Auch der Name von Arjunas Muschelhorn. Siehe auch Upaprāna.
Devakī f die Frau Vasudevas und Mutter Krishnas.
Devanāgarī f die „Schrift aus der Stadt der Götter“, die Sanskrit-Schrift, in der auch einige moderne indische Sprachen wie Hindī notiert werden.
Devarshi [devarṣi] m göttlicher Seher, Seher aus der Himmelsregion wie z.B. Nārada.
Devatā f Gottheit, das Bild einer Gottheit.
Devayāna n der Weg der Götter (deva-yāna), der Weg, der zu den Göttern führt; Weg der Weisheit und spirituellen Erkenntnis.
Siehe auch Pitriyāna.
Devayānī f Name der Mutter Yadus, des Begründers der Yādava-Dynastie.
Devī f Göttin, weibliche Gottheit im Hinduismus, bezeichnet oft Shivas Gefährtin.
Devi, Indra eine bedeutende Wegbereiterin des Yogas im Westen (1899-2002) und bekannte Schülerin von T. Krishnamacharya.
Indra Devi wurde 1899 in Riga im heutigen Lettland unter dem Namen Eugenie Peterson als Tochter eines Schweden und einer Russin geboren. Sie machte eine Ausbildung als Schauspielerin in Moskau, flüchtete jedoch nach der Machtübernahme der Kommunisten nach Berlin, 1927 reiste sie nach Indien, nachdem sie ein Werk Rabindranath Tagores und einige Bücher über Yoga gelesen hatte.
In Indien wirkte sie unter dem Künstlernamen Indra Devi in einigen Hindi-Filmen mit und wurde erste westliche Schülerin von T. Krishnamacharya, der sie zur Yoga-Lehrerin ausbildete. Daraufhin reiste sie in die USA und hatte dort viele prominente Schülerinnen, darunter auch Greta Garbo. 1966 wurde sie Anhängerin von Sathya Sai Baba und ging 1982 auf Einladung von Schülern ihres Meisters nach Argentinien, wo sie bis an ihr Lebensende als renommierte Yoga-Lehrerin tätig war.
Devīmahātmya n ein Gedicht mit 700 Versen, welches die Taten von Shivas Gefährtin, der Shakti, und ihre Siege über die Asuras preist. Der Text erscheint als ein Abschnitt im Mārkandeyapurāna.
Dhairya n Stetigkeit, Beständigkeit im Yoga.
Dhāma m Stätte, heiliger Ort, Zentrum der Anbetung einer Gottheit. Besonders bekannt sind Badrināth im Himālaya, Purī in Orissa, Dvārakā in Gujerāt und Rameshvaram an der Südspitze Indiens. (Siehe auch diese Orte.)
Dhanamjaya [dhanaṁjaya] m einer der fünf sekundären Lebenshauche, soll selbst nach dem Tod im Körper verbleiben. Wörtl. die Eroberung (jaya) von Reichtum (dhana). Auch ein Name Arjunas.
Siehe auch Upaprāna.
Dhanurāsana n Bogenhaltung; Rückbeuge aus der Bauchlage.
dhanuḥ – Bogen; āsana – Haltung. Nach einem Lautgesetz wird dhanuḥ zu dhanur.
Dhanurveda m der Veda der Kunst des Bogenschießens, ein Upaveda.
Dhanvantari m der Arzt der Götter, gilt als Urautor des Āyurveda, der ihm der Legende nach von Brahmā offenbart wurde.
Beim Quirlen des Milchozeans erschien er mit dem Gefäß, welches das kostbare Amrita enthielt.
Dhāranā [dhāraṇā] f Konzentration, Aufmerksamkeit, von der Wurzel dhṛ, halten. Bezeichnet die sechste Stufe im Rāja-Yoga, die Fixierung des Geistes auf einen bestimmten Gegenstand. Während der mentale Geist normalerweise hin und her springt, wird er durch Dhāranā dazu gebracht, länger und kontinuierlicher bei einem Objekt eigener Wahl zu verweilen, was auf Dhyāna, Meditation vorbereitet.
Dharma m Recht, Gesetz, Ordnung, Moralkodex, von der Wurzel dhṛ, halten, tragen. Der Dharma im spirituellen Sinn ist die rechte Lebensweise im Einklang mit den vedischen Schriften. Deren Nichtbefolgung ist Adharma.
Das Wort Dharma kann auch Wesen, Charakter, Eigenschaft bedeuten, ebenso wie Religion. So bezeichnen die Hindus ihren Glauben als Sanātana Dharma, die ewige Religion. Detaillierte Lebensregeln und Rechtsbestimmungen wurden von Manu im Dharmashāstra niedergelegt.
Dharma kann auch als Gott auftreten, welcher Recht und Gesetz verkörpert. So heißt es, dass Yudhishthira, der älteste der Pāndavas, von Dharma gezeugt wurde.
Dharmakshetra [kṣetra] n das Feld (kshetra) des Dharma. Im ersten Vers der Bhagavadgītā Bezeichnung für das Feld, auf dem die Pāndavas gegen ihre verfeindeten Vettern, die Kauravas, kämpften, um die höhere Ordnung, Dharma, wiederherzustellen.
Dharma-Megha-Samādhi m der „Dharma-Wolken-Samādhi“, erwähnt in Yogasūtra 4.29. Dies ist die höchste Form des Asamprajñāta-Samādhi, „verbunden mit dem Erlöschen der Kleshas (Leidursachen) und des Karma“ (4.30).
Bezüglich der Bedeutung des Begriffes Dharma-Megha gibt es mehrere Erklärungsversuche. Am überzeugendsten erscheint die Interpretation Shankaras, der in seinem Kommentar zum Yogasūtra schreibt, Dharma-Megha bedeute das Ausschütten (wie ein Wolkenguss) des höchsten Dharma, d.h. von Kaivalya, spiritueller Befreiung.
Читать дальше