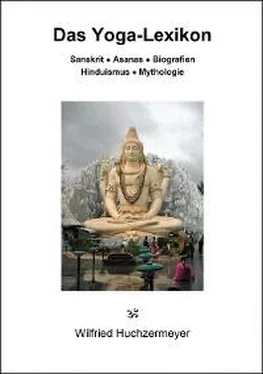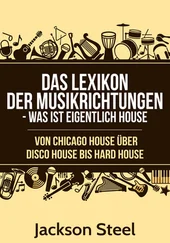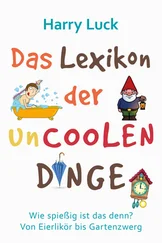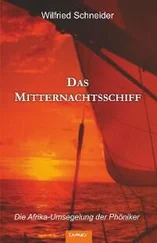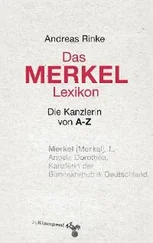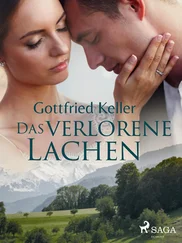Am 14. Februar 1984 verließ Babaji seinen Körper, nachdem er dies bereits zu Beginn seines Wirkens einigen wenigen Schülern vorab angekündigt hatte.
Bādarāyana [bādarāyaṇa] m Autor (4. Jh. v.Chr.) der Brahmasūtras, einer Aphorismensammlung der Vedānta-Philosophie, auch Vedānta-Sūtras genannt.
Badarinātha [Sanskrit], siehe Badrināth [Hindī]
Baddha gebunden, geschlossen. Ein Wortelement in Āsana-Bezeichnungen.
Baddhakonāsana n geschlossene Winkelhaltung; Schmetterling.
baddha – gebunden, geschlossen; koṇa – Winkel; āsana – Haltung.
Baddhapadmāsana n gebundene Lotushaltung.
baddha – gebunden; padma – Lotus; āsana – Haltung.
Baddhakonārdhacakrāsana, baddha-konārdha-cakrāsana n die Schulterbrücke mit angewinkelten Beinen; „gebundene Winkel-Halb-Kreis-Haltung“.
baddha – gebunden; koṇa – Winkel; ardha – Halb-; cakra – Kreis; āsana – Haltung.
Badrināth [Hindī], Badarinātha [Sanskrit] m bedeutende Pilgerstätte hoch im Himālaya, dem Vishnu geweiht. badari-nātha bedeutet wörtl. „Herr des Badari-Baumes“.
Bahiranga n der äußere Teil (bahir-aṅga), bezeichnet im Yogasūtra die ersten fünf der acht Stufen des Yoga.
Siehe auch Antaranga und Ashtānga-Yoga.
Bāhyakumbhaka m oder n das Anhalten des Atems (kumbhaka) nach voller Ausatmung (bāhya, wörtl. „äußerlich“).
Bakāsana n Kranich-Haltung.
baka – Kranich; āsana – Haltung
Bālakrishna [bālakṛṣṇa] m das „Krishna-Kind“, d.h. Krishna in seinem Aspekt als fröhlich spielendes Kind in Vrindāvan.
Balarāma m Krishnas älterer Bruder, der siebte Sohn von Devakī bzw. von Rohinī, in deren Schoß er auf wundersame Weise transferiert wurde, um ihn vor dem Zugriff des Despoten Kamsa zu schützen.
Siehe auch Krishna.
Bālāsana n die Kind-Haltung.
bāla – Kind; āsana – Haltung.
Bali (1) m Gabe, Opfergabe, insbesondere in Form von Korn oder Reis für die Hausgötter.
Bali (2) m Name eines mächtigen Daitya oder Dämonen, der von Vishnu bezwungen wurde. (Siehe Vāmana.)
Bandha m Bindung, Verbindung, Kontraktion. Im Hatha-Yoga Bezeichnung für eine bewusst herbeigeführte Muskelkontraktion, um Energien an einem bestimmten Punkt im Körper zu konzentrieren. Siehe Jālandhara-Bandha, Mahā-Bandha, Mūla-Bandha, Uddīyāna-Bandha.
Das Wort bandha ist verwandt mit dt. Band, binden und bedeutet auch die Gebundenheit an Unwissenheit (Avidyā) und den Kreislauf der Geburten.
Banyān [Hindī], Nyagrodha m [Sanskrit] der indische Feigenbaum, Ficus Indica, ein den Hindus heiliger Baum. nyagrodha bedeutet „herabwachsend“, weil von den Ästen Sprosse zu Boden wachsen und von dort neue Stämme bilden.
Siehe auch Vriksha.
Baum, Bäume siehe Vriksha.
Bernard, Theos Casimir ein bedeutender Yoga-Pionier in den USA (1908-1947), der als einer der ersten Amerikaner auch weit fortgeschrittene Hatha-Yoga-Praktiken meisterte, worüber er eine Dissertation an der Columbia University schrieb, die 1944 auch als Buch erschien.
Bernard starb 1947 während einer Forschungsreise in Tibet, als er und seine Träger von einem Stamm überfallen wurden.
Bestattung [Skrt. Pretakarma u.a. Begriffe] Im Hinduismus ist die Feuer-Bestattung üblich, Ausnahmen werden bei bedeutenden Yogīs gemacht.
Die Leiche wird vor der Bestattung frisch gekleidet und, insbesondere in Südindien, vielfältig mit Blumengirlanden geschmückt. Die Verbrennungsstätten liegen häufig in der Nähe eines Flusses, besonders bekannt sind jene am Ganges.
Die Leiche wird in Verbindung mit besonderen Ritualen verbrannt, wobei in der Regel der älteste Sohn oder ein anderer sehr nahestehender Verwandter das Feuer entzündet.
Auch nach der Bestattung werden weiterhin Riten wie Waschungen und Mantra-Rezitationen von den Teilnehmern durchgeführt.
Die Überbleibsel der Verbrennung werden nach ein oder zwei Tagen in einer Urne gesammelt und in einen Fluss gegeben oder auch in der Erde vergraben.
Im letzten Stadium werden Riten durchgeführt, die sicherstellen sollen, dass die dahingegangene Seele in der jenseitigen Welt ihren rechten Platz unter den Ahnen findet und nicht zu einem Geisterwesen wird.
Der Grundgedanke hinter der Feuerbestattung ist die Vorstellung, dass eine Seele sich nur dann in einem neuen Körper inkarnieren kann, wenn der alte völlig aufgelöst ist. Für große Yogīs gelten jedoch eigene Gesetzmäßigkeiten, ihr Körper wird als zu geheiligt angesehen, um verbrannt zu werden. Er bereichert die Erde, so wie die Relikte eines Heiligen einem Schrein besonderen Wert verleihen.
Bewusstsein nach der Yoga-Philosophie existiert Bewusstsein unabhängig vom menschlichen Gehirn, es ist eine ureigene Eigenschaft des höchsten Selbstes, dessen unendliches Bewusstsein die Grundlage des begrenzten menschlichen ist.
Siehe auch Purusha, Cit.
Bhadrapadā f Name des sechsten Monats im Hindu-Kalender (August/September).
Bhadrāsana n segensreiche Haltung, Bezeichnung für eine Sitzpositon; Schmetterling.
bhadra – gut, schön, glückverheißend; āsana – Haltung.
Bhaga m gutes Glück, Wohlergehen; Würde, Glanz; Liebe.
Name eines Āditya, einer vedischen Sonnengottheit, die Wohlstand schenkt und Liebe und Ehe schützt.
Bhagavadgītā [dt. Bhagavadgita, Bhagavad Gita] f Gesang des Herrn, Gesang des Erhabenen. Die bekannteste aller indischen heiligen Schriften, erscheint als Episode in dem Epos Mahābhārata (6.23-40) und umfasst 18 Kapitel mit insgesamt 701 Versen.
Die Gītā, wie der Text oft auch kurz genannt wird, gibt einen Dialog zwischen Krishna und Arjuna wieder, kurz bevor eine große Schlacht zwischen zwei verfeindeten Familien beginnt, deren Problematik eine tiefe Krise in Arjuna auslöst. In langen Vorträgen ermutigt Krishna Arjuna, um des Dharma willen für eine gerechte Sache zu kämpfen, und erläutert dann, teils ohne Bezug auf die ursprüngliche Thematik, ausführlich verschiedene Yoga-Wege, vor allem den dreifachen Pfad von Karma-, Jñāna- und Bhakti-Yoga, d.h. den Yoga der Werke, der Erkenntnis und Liebe. Diese werden als Einheit gesehen und verschmelzen zu einer Synthese, aber dennoch wird von Kommentatoren gern der eine oder andere Aspekt, z.B. Bhakti, als besonders bedeutsam hervorgehoben.
Ein Höhepunkt in der Gītā ist im 11. Kapitel Arjunas Vision von Vishnu-Krishna als Allgott, in dessen Leib die ganze Welt mit ihren Göttern und Wesen vereinigt ist. Diese Erfahrung ist so überwältigend wie „das Licht von tausend Sonnen“ und Arjuna kann sie kaum ertragen.
In ihrem philosophischen Weltbild integriert die Gītā eine Reihe von Grundgedanken der traditionellen vedischen Philosophie. Neben Ātman und Brahman begegnen wir auch einem „Purushottama“, der als höchstes göttliches Wesen den Lauf der Welt letztlich lenkt.
Einige der meistzitierten Verse aus der Gītā sind die folgenden: „Du hast ein Recht auf Werke, nicht jedoch auf deren Früchte.“ „Aus dem Yoga heraus tue deine Werke, ohne Anhaftung.“ „Wer mich überall sieht und alles in Mir, dem gehe ich nicht verloren, noch geht er mir verloren.“
Viele bekannte indische Yogīs haben ihren Schülern die Lektüre der Gītā empfohlen. Auch bei einigen westlichen Dichtern und Denkern fand der Text Anklang, und er wurde in zahllosen Übersetzungen veröffentlicht.
bhagavadgītā ist ein Kompositum aus bhagavat, der Erhabene, Göttliche, und gītā, Gesang. Aufgrund einer Lautregel wird bhagavat zu bhagavad.
Siehe auch Mahābhārata.
Bhagavān s.u. Bhagavat.
Bhagavat adj und m der Erhabene, Göttliche, Selige. Von bhaga-vat: derjenige, der „bhaga“ hat, d.h. Würde, Schönheit, Wohlergehen, Majestät. Das Wort ist in dieser Form der Stamm, der Nominativ ist bhagavān. Letzteres wird manchmal Namen von großen Yogīs als Ehrentitel vorangestellt.
Читать дальше