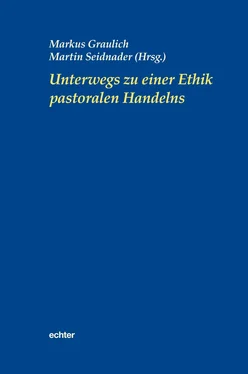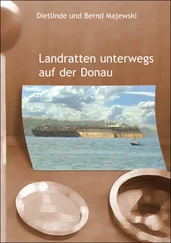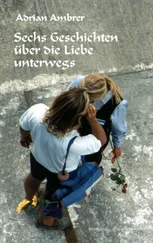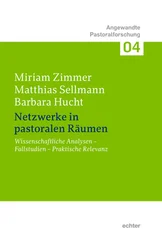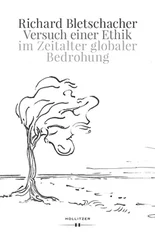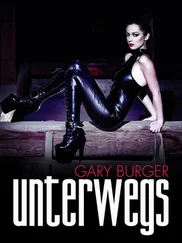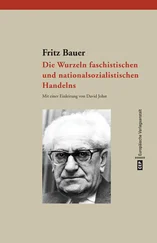Mit gebotener Sorgfalt ( debita cum diligentia ) hat der Bischof die Diözese zu visitieren, um sich vor Ort ein Bild machen und die Gläubigen des ihm anvertrauten Bistums kennen lernen zu können. 46
Das Kennen der ihm anvertrauten Gläubigen ist selbstverständlich auch die Pflicht des Pfarrers einer Gemeinde sowie der Seelsorgerinnen und Seelsorger, die hauptamtlich an der Pastoral der Pfarrei mitarbeiten: „Um die Hirtenaufgabe sorgfältig wahrzunehmen, hat der Pfarrer darum bemüht zu sein, die seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu kennen; deshalb soll er die Familien besuchen, an den Sorgen, den Ängsten und vor allem an der Trauer der Gläubigen Anteil nehmen und sie im Herrn stärken, und wenn sie es in irgendwelchen Dingen fehlen lassen, soll er sie in kluger Weise wieder auf den rechten Weg bringen; mit hingebungsvoller Liebe soll er den Kranken, vor allem den Sterbenden zur Seite stehen, indem er sie sorgsam durch die Sakramente stärkt und ihre Seelen Gott anempfiehlt; er soll sich mit besonderer Aufmerksamkeit den Armen, Bedrängten, Einsamen, den aus ihrer Heimat Verbannten und ebenso denen zuwenden, die in besondere Schwierigkeiten geraten sind; auch soll er seine Aufgabe darin sehen, die Ehegatten und Eltern bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten zu stützen und die Vertiefung eines christlichen Lebens in der Familie zu fördern.“ 47Anders wäre auch die vorher schon angesprochene Anerkennung und Förderung des Anteils der Laien an der Sendung der Kirche nicht möglich. 48Zugleich gibt diese Erfordernis auch einen Hinweis auf die verantwortbare Größe einer Pfarrei: sie darf ein Kennen lernen der Gläubigen nicht erschweren oder gar verunmöglichen.
Damit jemand zum Pfarrer oder zum hauptamtlichen Mitarbeiter in der Seelsorge bestellt werden kann, ist seine Eignung zu prüfen und er hat „sich außerdem durch Rechtgläubigkeit und Rechtschaffenheit aus[zu]zeichnen, er muss durchdrungen sein von Seeleneifer sowie von anderen Tugenden und zudem die Eigenschaften besitzen, die für die Seelsorge in der in Frage kommenden Pfarrei nach dem allgemeinen und dem partikularen Recht gefordert werden.“ 49Wie in anderen Fällen auch, geht diese Eignungsanforderung des Kirchenrechts weit über die reine Rechtsnorm hinaus und greift in den Bereich der Ethik bzw. der ethischen Grundhaltungen über. Gleiches ist auch im Hinblick auf den Katalog der Amtspflichten und Obliegenheiten des Pfarrers zu sagen, 50der in entsprechender Weise auch für die hauptamtlichen Mitarbeiter der Seelsorge gilt. Auch die im Codex aufgelisteten Pflichten und Rechte der Kleriker 51sind geeignet, als Grundlage für einen Ethikkodex der Seelsorge zu dienen, ohne dass dies hier genauer entfaltet werden kann. 52
2.4 Die Sakramente: recht gefeierter Glaube
Wichtige Bausteine für eine Ethik pastoralen Handelns finden sich darüber hinaus im Sakramentenrecht, gehört doch die Feier der Sakramente neben der Verkündigung des Wortes zu den unaufgebbaren Bestandteilen der Sendung der Kirche. 53Die Feier der Sakramente ist eine der Gelegenheiten, an denen die gemeinsame Teilhabe an der Sendung der Kirche besonders deutlich wird: „Der christliche Gottesdienst, in dem das gemeinsame Priestertum der Gläubigen ausgeübt wird, ist ein Tun, das aus dem Glauben hervorgeht und darauf beruht; deshalb haben sich die geistlichen Amtsträger eifrig zu bemühen, den Glauben zu entfachen und zu erhellen, vor allem durch den Dienst am Wort, durch das er erzeugt und genährt wird.“ 54An ihm haben nicht nur die Kleriker, sondern „auch die übrigen Gläubigen den ihnen eigenen Anteil, indem sie sich auf ihre Weise tätig an den liturgischen Feiern, besonders an der Feier der Eucharistie, beteiligen; auf besondere Weise haben an demselben Dienst die Eltern Anteil, indem sie ihr Eheleben in christlichem Geiste führen und für die christliche Erziehung ihrer Kinder sorgen.“ 55Dieser Anteil ist in besonderer Weise von den Seelsorgerinnen und Seelsorgern anzuerkennen, die dadurch ebenfalls zu erkennen geben, dass es in der Pastoral der Kirche nicht um eine Trennung zwischen Subjekten und Objekten der Seelsorge geht, sondern darum, dass „bei den liturgischen Feiern … jeder, sei er Liturge oder Gläubiger, in der Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das tun [soll; M.G.], was ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt.“ 56
Es wäre reizvoll, ist aber hier nicht möglich, nun die ethischen Konnotationen des Sakramentenrechts im Einzelnen durchzubuchstabieren. Ich beschränke mich daher auf einen allgemeinen Hinweis, der m.E. eine ethische Grundhaltung der Sakramentenpastoral darstellt. Das allgemeine Kirchenrecht bestimmt: „Die geistlichen Amtsträger dürfen die Sakramente denen nicht verweigern, die gelegen darum bitten, in rechter Weise disponiert und rechtlich an ihrem Empfang nicht gehindert sind.“ 57Kein Seelsorger und keine Seelsorgerin kann also eigenmächtig Voraussetzungen für den Empfang der Sakramente benennen (dieses Recht steht allein der kirchlichen Autorität zu 58), sondern hat die Kriterien anzuwenden, welche tatsächlich universal- und partikularrechtlich bestehen. Dies gilt sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. D.h., die Anforderungen dürfen nicht höher geschraubt werden, als dies allgemein vorgesehen ist, sie dürfen aber auch nicht niedriger gesetzt werden. So ist z.B. die Tatsache, dass die Eltern eines Täuflings nicht in einer kirchenrechtlich gültigen Ehe leben, kein Grund, diesem Kind die Taufe zu verweigern; sie ist aber Einladung, die Eltern auf ihrem Weg seelsorglich zu begleiten und sie ggf. zu einer kirchlichen Eheschließung zu führen, ohne dass davon die Taufe des Kindes abhängig gemacht werden könnte. Genauso ist es weder ethisch noch pastoral zu verantworten, Sakramentenspendungen in Aussicht zu stellen oder gar vorzubereiten, in dem klaren Wissen darum, dass die Voraussetzungen dazu fehlen und sie dann „höhernorts“ in letzter Minute doch noch verhindert oder später als ungültig erklärt werden. Der Seelsorger hat dann zwar den „Schwarzen Peter“ weiter geschoben, seiner ethischen Verantwortung ist er nicht gerecht geworden. Hier lädt das Kirchenrecht zum verantwortlichen Handeln ein, wenn es festlegt: „Die Seelsorger und die übrigen Gläubigen haben jeweils gemäß der ihnen eigenen kirchlichen Aufgabe die Pflicht, dafür zu sorgen, dass jene, die Sakramente erbitten, auf ihren Empfang durch die erforderliche Verkündigung und katechetische Unterweisung unter Beachtung der von der zuständigen Autorität erlassenen Normen vorbereitet werden.“ 59Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2.5 Die Räte: ehrliche Mitverantwortung
Wenn alle Gläubigen ihrem Stand und ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechend an der Sendung der Kirche teilhaben und für sie Mitverantwortung tragen, ist es konsequent, dass sich diese Mitverantwortung auch im gemeinsamen Tun zeigt. So sind etwa Vertreter des Presbyteriums eingeladen, im Priesterrat mit dem Bischof zusammenzuwirken. Die Aufgabe des Priesterrates besteht darin, „den Bischof bei der Leitung der Diözese nach Maßgabe des Rechts zu unterstützen, um das pastorale Wohl des ihm anvertrauten Teiles des Gottesvolkes so gut wie eben möglich zu fördern.“ 60Ebenso sieht das Kirchenrecht vor, dass „Laien, die sich durch Wissen, Klugheit und Ansehen in erforderlichem Maße auszeichnen, … befähigt [sind], als Sachverständige und Ratgeber, auch in Ratsgremien nach Maßgabe des Rechts, den Hirten der Kirche Hilfe zu leisten.“ 61Dies geschieht etwa im Diözesanpastoralrat 62oder im Pfarrpastoralrat 63oder aber im Partikularkonzil 64und der Diözesansynode. 65So, wie in der Diözesansynode der Bischof einziger Gesetzgeber bleibt und allen anderen Mitgliedern nur beratendes Stimmrecht zukommt, 66ist auch die Mitarbeit der Gläubigen in den anderen Räten der Kirche vor Ort eine Mitarbeit, die in der Regel auf Beratung abzielt und sicherstellen kann, dass die Verantwortlichen den Blick für die pastoralen Realitäten in Pfarrei und Bistum nicht verlieren.
Читать дальше