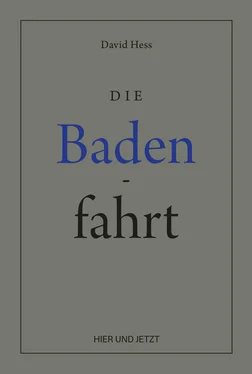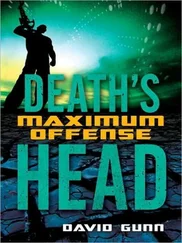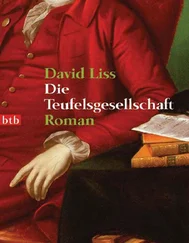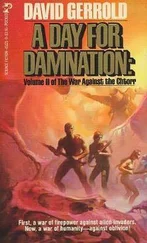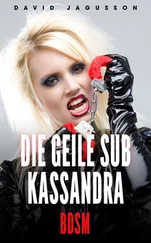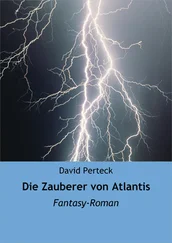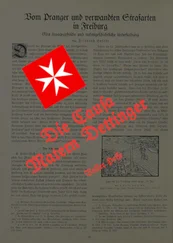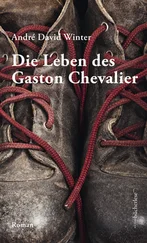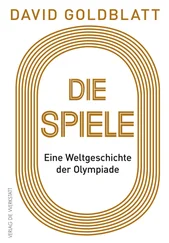Wer hingegen ruhebedürftig, im Familienkreis auf seinem Zimmer speist, hat es im Grunde daselbst weit gemächlicher, nur so viel und gerade diejenigen Schüsseln, welche man vorzüglich liebt oder bedarf, und die Kinder, welche vor dem zwölften Jahr nie an Wirtstafeln mitgebracht werden sollten, können von keinen allzu gefälligen Nachbarinnen mit Naschereien überfüttert werden und hören keine Gespräche, die nicht für ihr Alter passen. Ich halte es für einen der grossen Vorzüge von Baden, dass es hier noch immer einem jeden frei steht, sich nach Willkür auf seinem Zimmer bedienen zu lassen.
Im Hinterhofe habe ich sowohl die Speisen an der öffentlichen Tafel als diejenigen, welche ich mir auf mein Zimmer bringen liess, immer gut zubereitet gefunden, auch sind die Portionen hinreichend für jeden, der nicht aus dem Geschlecht der Gargantua stammt. Und wenn im Staadhofe bei gleicher, vielleicht grösserer Mannigfaltigkeit der Gerichte die Kocherei nicht immer gleich sorgfältig behandelt werden kann, so ist das nur der Fall, wenn gar zu viele Gäste auf einmal bewirtet werden müssen. In andern Häusern habe ich noch nie gespeist. Wer indes einen hohen Wert auf Leckerbissen setzt und eine gastronomische Kur gebrauchen will, der muss von hier nach Schinznach reisen.
Gemüse, zumal feinere, sind in Baden noch immer etwas selten. Die Wirte haben nicht Zeit, dergleichen durch ihre eigenen Leute im Überfluss pflanzen zu lassen; sie müssen dieselben den Stadtbürgern, die allmählich anfangen, welche zu bauen, sehr teuer bezahlen, und die benachbarten Bauern verstehen nichts von Gartenkultur und denken nicht daran, dass sie damit ein einträgliches Gewerbe treiben könnten. Wer also feinere vegetabilische Nahrung andern Speisen vorzieht, tut wohl, sich alle Wochen ein paarmal frische Gemüse von Zürich kommen zu lassen, was durch die Schiffe bequem und wohlfeil geschehen kann.
Auf dem Zimmer speist man indes auch nicht immer ganz ungestört. Da ist des Anpochens kein Ende. Die Zuckerbäckerinnen machen um diese Zeit wieder ihre Runde, und Kinder von den benachbarten Weilern strecken ihre oft mit unreinen Händen gepflückten Erd-, Heidel- und Brombeeren auf schmutzigen, zinnernen Tellern durch die von ihnen selbst geöffnete Türe herein und räumen selten den Fleck, bis sie sich, ohne eigentlich arm zu sein, etwas Brot oder andere Lebensmittel erbettelt haben. Dergleichen Früchte sollten bloss auf bestimmten Plätzen feilgeboten werden, wie es mit anderem Obst auf dem heissen Stein vor dem Staadhofe geschieht.
Auf den Gassen wird man sonst hier durch keinerlei Bettel belästigt. Die überall verteilten Landjäger halten streng auf Zucht und Ordnung. Sie richten auch kleine Aufträge in der Nachbarschaft aus und überbringen den Gästen die mit den Schiffen anlangenden Pakete und Briefe.

Die Matte.
DER LITERARISCHE NACHMITTAG
Wer an keiner Wirtstafel gespeist hat und gleich nach dem Essen lieber ein stilles Stündchen im Freien zubringt, statt sich beim Nachtisch in den dumpfen, geräuschvollen Sälen zu verweilen und mit allerlei Badgästen in allen Winkeln stehen zu bleiben und zu plaudern, der findet bis gegen drei Uhr die Matte meistens einsam. Bei der grössten Hitze ist es da immer kühl und schattig im Grünen. Man setzt sich auf die untere Bank an die Limmat, wo der muntere Strom seine klaren Wellen rauschend vorübertreibt, auf welchen malerische Reflexe schwimmen und je nach der verschiedenen Beleuchtung in wechselnden Farben spielen. Oder man begibt sich auf die Bank unter der Linde am hintersten Ende des Platzes. Hat man Frau und Kinder bei sich, so spielen die Kleinen auf dem ebenen Wiesenplan, indes die liebe Gefährtin strickend die ausgelassene Jugend im Auge behält, dass sie sich nicht zu nahe an das reissende Wasser hinwage. Der Mann raucht gemütlich sein Pfeifchen, dazwischen wird traulich geplaudert oder etwas gelesen. Wer nähme nicht gern ein paar unterhaltende Bücher mit sich nach Baden? Die anziehendste Lektüre ist immer diejenige, welche von einem bedeutenden Orte handelt, an dem man sich eben befindet und Stoff zu Vergleichungen über Sitten und Gebräuche der Vorzeit mit der Gegenwart darbietet.
Die Literatur über Baden ist ziemlich reichhaltig. Es haben unter anderen davon geschrieben:
J.F. Poggio Bracciolini, genannt der Florentiner, im Jahr 1417.
Henr. Gundelfinger, Canonicus Ecclesiae Beronensis. 1489. Ein seltenes Manuskript.
Alexander Sytz, von Marbach: Menschliche Lebens-Art und Ursprung und wie man das befristen soll durch die Wildbäder zu Oberbaden. Auch von deren Kraft, Tugend und Eigenschaft, und wie man sich darinnen halten soll. Basel 1510.
Dieses Buch, obgleich es oft angeführt wird, ist selten mehr zu finden und eigentlich eher eine allgemeine Anleitung zum Gebrauch der Bäder als eine Beschreibung derjenigen von Baden insbesondere. Sytz scheint sich als Arzt und Geburtshelfer in Baden aufgehalten,* dort aber durch politische Umtriebe so unnütz gemacht zu haben, dass er auf Befehl der regierenden Stände durch den Landvogt eingezogen ward und das Urteil erging, er solle Urfehde schwören und das Land verlassen. Darüber erschraken die Frauen von Baden und erliessen eine Bittschrift an die Stände, welche ich ihrer Eigentümlichkeit wegen in einer Beilage am Ende dieses Buches einrücke. Das Original befindet sich in der Sammlung des Herrn Schultheiss von Mülinen zu Bern.
Sebastian Münster, in seiner Cosmographia universalis. 1550.
Conrad Gessner, in dem zu Venedig gedruckten Werk: De Thermis et Fontibus Medicatis Helvetiae et Germaniae. 1552.
Darin sind Auszüge aus Gundelfingers Werk und ist auch Alexander Sytz erwähnt.
Dr. Joh. Jac. Huggelin, in seinem Büchlein:* Von heilsamen Bädern des Teutschenlands. 1559.
Dr. Georg Pictorius in seinem Baderbüchlein. Ganz kurzer Bericht von allerhand einfachen und 38 komponierten mineralischen Deutschlands Wildbädern etc. 1560.
Dr. Heinrich Pantaleon. 1578.
Michel de Montaigne. 1580.
Ohne den Namen des Verfassers und ohne Angabe des Druckortes erschien im Jahre 1619 ein Buch in Folio unter dem Titel: Kurze und eigentliche Beschreibung des Ursprungs, Kraft, Nutzbarkeit und Gebrauchs des edlen, weitberühmten warmen Bads zu Baden im Aargau in der lobl. Eidgenossenschaft etc. Dasselbe ward im Jahre 1683 zum zweiten und 1730 zum dritten Mal in Baden wieder aufgelegt, ist selten geworden und soll kurze veraltete Sätze über den Gebrauch und die Kräfte dieses Bades enthalten. 24Matthäus Merian in seiner Topographie. 1642.
Joh. Jac. Wagner in seinem Mercurius Helveticus. 1688.
Salomon Hottinger: Thermae Argoviae-Badenses; d. i. Eigentliche Beschreibung der warmen Bäder zu Baden. 1702.
Abraham Ruchat in seinen Délices de la Suisse, 1714, unter dem geborgten Namen Gottlieb Kypseler de Münster. Dieses Buch ist in der Folge noch mehrmals aufgelegt und verbessert worden.
Joh. Jac. Scheuchzer, zuerst in seiner Hydrographia Helvetica. 1717. Ein Auszug aus Salomon Hottingers Werk nebst beigefügten eigenen Bemerkungen.
Dann in den Actis Academiae Naturae Curiosorum. 1730: Otia aestivalia circa Thermas Badenses Helveticas, und daselbst auch: De Salis Badensis thermalis effectu und von den sich gern in diesen Bädern aufhaltenden Heimchen (Grilli).
Ferner ein eigenes Werk in Quart nebst sechs Kupferstichen: Vernunftmässige Untersuchung des Bads zu Baden, dessen Eigenschaften und Wirkungen. 1732.
Und endlich in der zweiten Ausgabe seiner Naturhistorie des Schweizerlands. 1752.
Dav. F. de Merveilleux: Amusements des Bains de Bade en Suisse. 1739.
Hs. Heinr. Bluntschli in seinen Merkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich. 1742.
Читать дальше