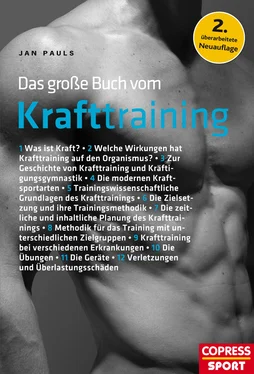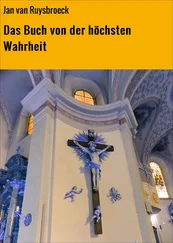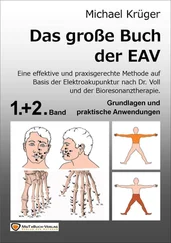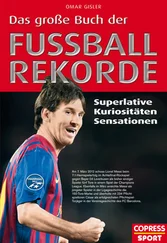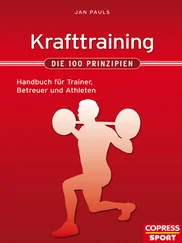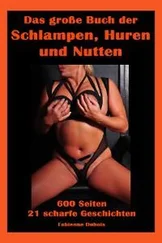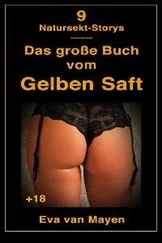Extremes Muskelwachstum findet man vor allem bei Bodybuildern, die bei einem Körperfettanteil von 6–10% [212] häufig über 100 durchtrainierte Kilos auf die Waage bringen. Arnold Schwarzenegger wog in seiner aktiven Zeit bei 1,88 m Körpergröße 109 Kilogramm. Lee Haney, Star der 80er Jahre im Bodybuilding, brachte bei 1,80 m etwa 112 Kilogramm Wettkampfgewicht auf die Waage.
Gewichtheber haben ebenfalls einen sehr hohen Anteil an Muskelmasse, der durchaus im Bereich von 55% der Körpermasse liegen kann. Der Körperfettanteil liegt bei Gewichthebern der unteren Gewichtsklassen häufig unter 10%, in den höchsten Klassen, insbesondere im Superschwergewicht, z.T. deutlich höher. Dies ist der Hebeleistung allerdings nicht abträglich. Die höchsten absoluten Maximalkraftleistungen zeigen ohnehin normalerweise die endomesomorphen Konstitutionstypen, d.h. Sportler, die eine eher massive Gestalt mit einer Neigung zu einer großen Muskelmasse und gleichzeitig einem erhöhten Körperfettanteil aufweisen [215].
2.2Die Wirkung auf Knochen, Sehnen und Gelenke
Auch die Knochen, der Kapsel-Bandapparat der Gelenke, Knorpelstrukturen und die Sehnen, die die Verbindung zwischen Muskel und Knochen darstellen, zeigen Anpassungen an ein Krafttraining. Der Knochen erhöht, ausgelöst durch die Zug- und Druckspannungen, die bei einem Krafttraining über die Muskeln und die Schwerkraft auf ihn einwirken, seine Mineraldichte und seinen Durchmesser. Daraus resultiert eine erhöhte Knochenfestigkeit und -stabilität. Ferner organisiert sich die Knochenbinnenstruktur entsprechend der Richtung der auf sie einwirkenden Kräfte. Dieser Einfluss auf die Knochenstabilität macht Krafttraining zu einer geeigneten therapeutischen Maßnahme bei einem Knochenfestigkeitsverlust in Form einer Osteopenie oder Osteoporose (Kap. 9.5). In einer Vergleichsstudie von sieben Sportarten zeigten Gewichtheberinnen mit Squashspielerinnen die höchsten Knochendichtewerte. Die mechanischen Belastungsspitzen in diesen Sportarten bewirkten bei den Sportlerinnen eine erhöhte Knochenstabilität, während bei Ausdauersportarten (Radfahren, Aerobic, Skilanglauf) keine oder nur geringe Erhöhungen gefunden wurden [88]. Unter Umständen halten die positiven Effekte auf das Knochensystem noch viele Jahre nach Absetzen des Trainings an. Man fand bei ehemaligen Gewichthebern eine erhöhte Knochenmasse gegenüber einer Vergleichsgruppe bis ins siebte Lebensjahrzehnt hinein [108]. Messbare Anpassungen der Knochenstruktur an ein Krafttraining benötigen allerdings mehrere Monate [42].
Die erhöhte Festigkeit der Sehnen durch Training resultiert ebenfalls aus einer Zunahme ihrer Dicke und einer Verdichtung ihrer inneren Struktur. Die Vermehrung des für hohe Zugbelastungen ausgerichteten Kollagens, dem Hauptbaustoff der Sehnen, spielt hierbei die wesentliche Rolle [42]. Ferner führt die Beanspruchung der Sehne durch körperliche Aktivität zu einer massiven Steigerung der Durchblutung und des Sehnenstoffwechsels [117]. Bei Ultraschalluntersuchungen fand man im Schulterbereich bei Bodybuildern eine ausgeprägte Verdickung der Sehnen der sog. Rotatorenmanschette. Je öfter die Sportler den Schulterbereich pro Woche trainierten, desto deutlicher war die Dickenzunahme der Sehnen [105]. Auch für die Bänder und die Gelenkkapsel, die ebenfalls im Wesentlichen aus Kollagen aufgebaut sind, erhöht sich die Festigkeit durch ein Krafttraining. Diese erhöhte Stabilität des Sehnen- und Kapsel-Bandapparates schützt den Sportler vor Verletzungen.
Knorpelgewebe, das alle Gelenkflächen im Körper überzieht, durchläuft ebenfalls Anpassungen an die mechanische Belastung durch ein Krafttraining. Während eine Ruhigstellung von Gelenken (z.B. Gipsverband) aufgrund der speziellen Ernährung des Knorpels durch Wechseldruck zum Absterben von Knorpelzellen und somit zur Knorpelzerstörung führt, löst die Belastung durch Training eine Zunahme der Knorpelzellen an Zahl und Größe sowie eine Zunahme der Interzellularsubstanz aus. Diese Hypertrophie des Gelenkknorpels führt zu einer besseren Druckverteilung und zu einer erhöhten »Pufferfunktion« (Absorption von Energie) bei mechanischer Belastung [42]. Neben dem Gelenkknorpel, der auch als hyaliner Knorpel bezeichnet wird, gibt es Faserknorpelstrukturen, die einen hohen Gehalt an Kollagenfasern aufweisen und eher für Zugbelastungen ausgelegt sind. Dies sind z.B. die Menisken im Knie und der Knorpelring der Bandscheibe. Durch Belastung, z.B. Krafttraining, erhöhen auch die faserknorpeligen Strukturen ihre Festigkeit. Dadurch ist es erklärbar, dass Gewichtheber und Kraft-Dreikämpfer enorme Lasten heben können, ohne dass die Bandscheiben unter dieser extremen Belastung zerstört werden.

Abb. 6: Die knochenaufbauende Wirkung eines Krafttrainings kann in der Prävention und Therapie von Osteoporose genutzt werden.
Bei den Anpassungen der beschriebenen Gewebe an Krafttrainingsreize ist zu berücksichtigen, dass diese Gewebe unterschiedliche Stoffwechselgeschwindigkeiten und damit unterschiedliche Geschwindigkeiten der Anpassung an Belastungsreize zeigen. Die Muskulatur hat einen sehr hohen Stoffwechsel im Gegensatz zu Sehnen- oder Knorpelgewebe. Deshalb wächst die Muskelkraft wesentlich schneller als die Festigkeit der übrigen Bewegungsstrukturen. Die Sehne beispielsweise braucht etwa das Dreifache an Zeit für ihre Anpassung an Belastungsreize wie der Muskel [69]. Knorpelgewebe hat sogar einen noch langsameren Stoffwechsel als die Sehne. Daher darf sich die Planung der Trainingsbelastung nicht nur an der muskulären Leistungsfähigkeit orientieren, sondern muss auch die Regenerations- und Anpassungsfähigkeit der übrigen Bewegungsstrukturen berücksichtigen.
2.3Die Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System
Während eines Krafttrainings steigt der Puls (= Herzschläge pro Minute) deutlich an, da der Organismus mehr Blut in die arbeitende Muskulatur befördern muss, denn Blut transportiert u.a. Sauerstoff und Energieträger, die von der Muskulatur für die Kontraktion benötigt werden. Die Blutpumpe des Körpers, der Herzmuskel, muss beim Training also mehr arbeiten als in Ruhe. Bei der Übungsdurchführung sind Pulsschläge im Bereich von 135 bis 170 nicht ungewöhnlich [61, 80, 138]. Diese Pulsfrequenzen entsprechen durchaus denen, die bei einem effektiven Herz-Kreislauf-Training, z.B. beim Jogging, erreicht werden mit dem entscheidenden Unterschied, dass beim Ausdauertraining der Puls ständig auf hohem Niveau bleibt, während er beim Krafttraining in den Pausen wieder deutlich abfällt. Häufig sinkt der Puls nach 30–60 Sekunden wieder auf sein Ausgangsniveau vor der Serie ab. Hohe Pulsfrequenzen werden vor allem bei Kraftübungen erreicht, die große Muskelgruppen beanspruchen (z.B. Beinpressen, Kniebeugen oder Kreuzheben), aber nur dann, wenn die Serie der Wiederholungen einen längeren Zeitraum beansprucht, wie beim Muskelaufbau- oder Kraftausdauertraining.
Weil der Puls beim Krafttraining nicht konstant auf höherem Niveau gehalten wird, sind die typischen Anpassungen, die das Herz-Kreislauf-System bei Ausdauersport (Jogging, Radfahren, Schwimmen) durchläuft, beim Kraftsportler nur sehr gering ausgeprägt.
Die Sauerstofftransportkapazität (bestimmt als maximale Sauerstoffaufnahme) steigt nach einem mehrwöchigen Krafttraining nur um wenige Prozent (3–4%) an. Beim Zirkelkrafttraining ist der Effekt aufgrund der höheren Belastungsdichte erwartungsgemäß etwas größer. In einer Studie von Gettmann und Mitarbeitern stieg die Herz-Kreislauf-Kapazität nach einem 12-wöchigen Zirkeltraining um 12% an [70]. Ansonsten wird bei einem Krafttraining nach dem Prinzip des Zirkeltrainings von Steigerungen der aeroben Kapazität von 5–8% ausgegangen [80]. Für höhere Effekte auf die maximale Sauerstoffaufnahme sollten die Pausenzeiten zwischen den Serien möglichst kurz (z.B. 10 sec.) gehalten und die Belastungsintervalle hochintensiv (große Muskelgruppen, hohe Intensität) gestaltet werden [211]. Eine solche globale Anstrengung des Gesamtkörpers behindert allerdings die lokale Leistungsoptimierung des Einzelmuskels in Hinblick auf die Steigerung von Muskelmasse und Kraftausdauer.
Читать дальше