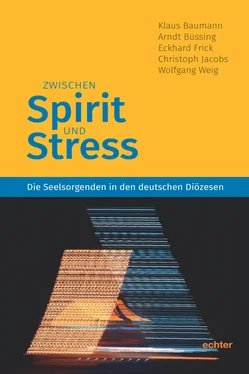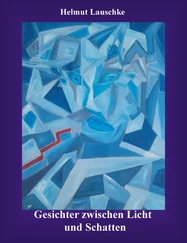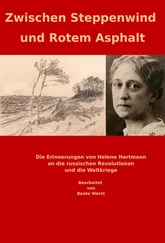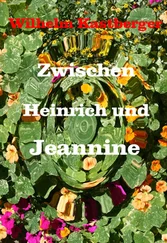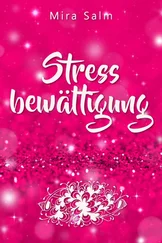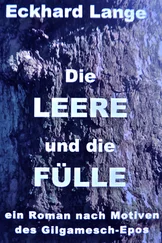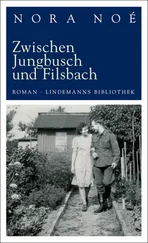Wohlwollen und Interesse an der Seelsorgestudie hatten zur Folge, dass diese viel mehr untersuchte Diözesen und befragte Personen umfasst als ursprünglich geplant. Was ursprünglich als (repräsentative) „Priesterstudie“ in einigen (Erz-)Bistümern geplant war, wurde zu einer Befragung aller pastoralen Berufsgruppen in den meisten deutschen Diözesen. Für diese Akzeptanz konnten wir sowohl eine „bottom-up“- als auch eine „top-down“-Bewegung wahrnehmen. „Von unten nach oben“, also an der pastoralen Basis der Bistümer, artikulierte sich in allen Berufsgruppen der Wunsch, teilzunehmen, informiert zu werden, mitzudiskutieren. Viele Bischöfe und Personalverantwortliche unterstützten die Studie und ihr Anliegen frühzeitig. Im April 2015 wurden die Ergebnisse der Seelsorgestudie in der Katholischen Akademie Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt – mit großem Medieninteresse. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz und die Kommissionen für Seelsorge (III) und für Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste (IV) sowie die Personalverantwortlichen der Diözesen widmeten der Seelsorgestudie eigene Sitzungen. Zusätzlich führten wir eine große Zahl von regionalen Informationsveranstaltungen in Diözesen und Fachkonferenzen durch. So erreichten wir frühzeitig eine Beteiligung der Experten in eigener Sache und der Verantwortlichen in den Diözesen.
Viele Verantwortliche in den Diözesen und Ordensgemeinschaften, Seelsorgerinnen und Seelsorger, Journalisten und andere interessierte Personen wünschten eine rasche Veröffentlichung des vorliegenden Buches. Trotz dieses berechtigten Informationsbedürfnisses – gerade seitens der gut 8000 an der Seelsorgestudie Teilnehmenden – entschieden wir uns für den langsameren und gründlicheren Weg, wie er in der Forschung üblich ist: zunächst Sicherung und Auswertung der Ergebnisse, Einreichung bei anerkannten Fachzeitschriften (Review-Prozesse) und gutachterliche Prüfung, erst dann zusammenfassende Veröffentlichung der Studienergebnisse in Buchform. Die Leserinnen und Leser des vorliegenden Buches können über die Webseite der Seelsorgestudie www.seelsorgestudie.comdie zu Grunde liegenden Fachpublikationen ermitteln und gegebenenfalls über wissenschaftliche Bibliotheken auf die Originalartikel zurückgreifen. So wird das vorliegende Buch von wissenschaftlicher Fachsprache entlastet. Die Leserinnen und Leser müssen also nicht den ‚Maschinenraum‘ der Seelsorgestudie betreten, um deren Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen. Dennoch bleiben die statistisch-methodischen Hintergrundinformationen jederzeit zugänglich und bilden die Grundlage für dieses Sachbuch.
Wir freuen uns, dass dieser Schritt in die Öffentlichkeit nach den genannten Vorarbeiten nun möglich ist. Wir bedanken uns bei den Männern und Frauen im kirchlichen Seelsorgedienst, die schriftlich und mündlich unsere Fragen beantwortet haben und uns auch ihre eigenen Fragen mitgegeben haben, die aus ihrer Lebens- und beruflichen Erfahrung stammen. Verantwortliche in Diözesen und Ordensgemeinschaften haben die Durchführung der Studie durch ihr Wohlwollen ermöglicht. Schließlich bedanken wir uns bei allen, die unsere Studie unterstützt haben, besonders bei unseren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Miriam Altenhofen, Vojtech Bohac, Andreas Günther, Philipp Kerksieck, Cécile Loetz, Carlos Ignacio Man Ging und Jakob Müller.
Klaus Baumann
Arndt Büssing
Eckhard Frick sj
Christoph Jacobs
Wolfgang Weig
2. Einleitung
Jedes Forschungsprojekt beginnt mit einer Forschungsfrage. Auch die Seelsorgestudie – nur fächert sich unsere in mehrere Themenbereiche auf. Im Vordergrund stand für uns die Frage nach der Lebens- und Arbeitssituation pastoraler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Schlüsselpersonen im Kontext der gegenwärtigen religiösen und pastoralen Wandlungsprozesse. Hier interessierte uns vor allem, wie es ihnen geht, wie ihre Gesundheit, Motivation und Lebenszufriedenheit erhalten und gefördert und wie ihre individuellen Ressourcen im Umgang mit Belastungssituationen unterstützt werden können. Im Hintergrund steht für uns die grundlegende Absicht, Gesundheit und Engagement im Dienst der Seelsorge zu fördern und damit zum Gelingen des Lebens von Seelsorgerinnen und Seelsorgern beizutragen. Dass ihre Spiritualität(en) und Lebensformen bei diesen Fragestellungen einen zentralen Raum einnehmen müssen, war eine ähnliche Grundannahme.
2.1. Theoretische Modelle
Wenn man die Frage nach Gesundheit, Motivation und Ressourcen von Personen stellt, ist es gut, sich auf bereits etablierte Denkmodelle in Medizin und Gesundheitspsychologie beziehen zu können. Für die Seelsorgestudie waren dies das Salutogenese-Konzept sowie das Anforderungs-/Ressourcen-Modell, die beide an anderer Stelle noch ausführlicher erläutert werden.
Das Salutogenese-Modell von Aaron Antonovsky hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als eine der bedeutsamsten Rahmenkonzeptionen der Gesundheitswissenschaften entwickelt. Es wird heute als Gegenentwurf zum Pathogenese-Mo-dell verstanden. Es fragt nach Gesundungsprozessen anstatt nach Erkrankungsprozessen. Sein Gesundheitsverständnis ist nicht auf die physische und/oder psychische Gesundheit enggeführt, sondern bezieht auch die geistige, soziale, kulturelle und spirituelle Dimension umfassend ein. Gesundheit und Krankheit können als fließende Übergänge („Bewegung“) auf einem theoretischen Kontinuum zwischen völliger Krankheit („dis-ease“ / Krankheit) und völliger Gesundheit („ease“ / Wohlgefühl) verstanden werden. Es handelt sich somit um Prozesse des „Werdens“ in Richtung Wohlbefinden und Zufriedenheit. Im Vordergrund steht nicht die Frage, was krank, sondern was gesund macht. Diese scheinbar polar gegensätzlichen Zustände sind natürlich idealisiert, sie beschreiben aber gut die „Anziehungspole“ für Gesundheits- und Krankheitsdynamiken. Die treibenden Faktoren dieser Bewegung sind zum einen die Ressourcen des Individuums, zum anderen der Interaktionsprozess zwischen dem Individuum und den Ressourcen des Lebensraumes. In diesem Geschehen gilt es die gesamte Person mit ihrer individuellen Lebensgeschichte (mit ihren Leibes- und Beziehungserfahrungen) im Kontext des gesamten Systems zu berücksichtigen, in dem sie lebt. Eine zentrale Rolle im Salutogenese-Modell nimmt das so genannte Kohärenzgefühl ein. Es ist eine globale Lebensorientierung, welche Individuen und soziale Systeme in die Lage versetzt, das Leben als verstehbar, gestaltbar und motivational sinnvoll zu begreifen.
Das salutogenetische Modell ist kein Konkurrenzmodell zu den bewährten alternativen ressourcenorientierten Modellen der Gesundheitsförderung. Vielmehr stellt es ein integrierendes und synthetisierendes Modell dar, welches als „umbrella-model“ verschiedener Rahmenkonzeptionen dienen kann. Im Unterschied zu den in der Medizin häufig dominierenden Pathogenese-Modellen sieht das Salutogenese-Konzept den Erfolg nicht darin, spezifische pathogene Erreger oder Prozesse bekämpfen zu können, sondern die Ressourcen zu stärken, die das Individuum widerstands- und anpassungsfähig machen. Im Salutogenese-Modell erfährt das bekannte Stressorkonzept im Einklang mit anderen bewährten Stress-Modellen eine entscheidende Modifikation : Der auf das Individuum zukommende oder in ihm auftretende Stressor führt nicht per se zu einem Disstresszustand, sondern zu einem physiologischen „Anspannungszustand“ aufgrund der verursachenden Anforderungen, mit dem das Individuum umgehen muss, um das ursprüngliche Gleichgewicht wieder herzustellen. Kann es diesen mit Hilfe seiner Ressourcen abpuffern bzw. bewältigen, so würde die entsprechende Person aufgrund von positiven Erfahrungen und Trainingseffekten mit einer (theoretisch) „robusteren“ Gesundheit aus der Konfrontation mit dem Stressor hervorgehen. Entscheidend für eine konstruktive Spannungsbewältigung ist die Palette der Ressourcen, die einem Menschen dafür zur Verfügung steht. Es können körperliche, geistige, seelische, soziale, kulturelle oder spirituelle Ressourcen sein.
Читать дальше