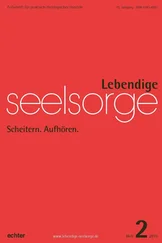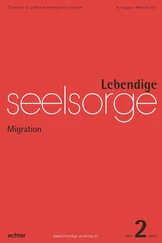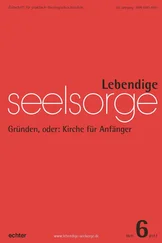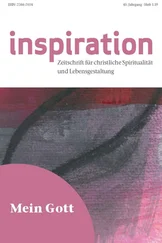Wie kann derselbe Mensch, der in seiner Zeit mit seinem Handeln aneckte und letztendlich dadurch den Tod fand, für heute lebende Christ(inn)en ein Vorbild sein für eine Spiritualität, die Mystik und Politik verbindet?
Das Christkönigsfest und die Ideologiekritik
Ein kurzer Blick in den zeitgeschichtlichen Kontext hilft zum besseren Verständnis. Als Pius XI. am 11. Dezember 1925 das Christkönigsfest einsetzte, war in Deutschland und Österreich, d.h. in den Ländern, in denen Metzger vorrangig wirkte, die monarchische Ordnung bereits aufgehoben. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die bisherigen Vorstellungen vom Königtum im religiösen wie auch politischen Raum präsent blieben und weiterhin ihre Prägekraft entfalteten. Die Christkönigsverehrung ging aus der Herz-Jesu-Verehrung hervor, die sich ab dem 19. Jh. zu einer der wichtigsten Formen katholischer Spiritualität entwickelte. Das Symbol des Herzens setzte emotionale Akzente: Nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen wollten sich die Katholiken in die Gesellschaft einbringen. An der Wende zum 20. Jh. wurde diese emotional akzentuierte Spiritualität zunehmend von einem Christusbild abgelöst, in dem vor allem dessen monarchische Attribute Berücksichtigung fanden.
Während des I. WK wurde die eigentlich friedfertige Herz-Jesu-Spiritualität in Frankreich und Deutschland dazu genutzt, um die katholischen Soldaten auf beiden Seiten zum möglichst engagierten Fronteinsatz und somit auch zum Töten ihrer Glaubensgenossen zu mobilisieren. Nach dem Kriegsende erstrebte Papst Pius XI. im Sinne seines Leitmottos Pax Christi in regno Christi 5die Veränderungen in Kirche und Gesellschaft mit friedlichen Mitteln, aber in offensiver Weise aktiv mitzugestalten. Mit der Einführung des Christkönigsfestes wurde eine dezidiert christozentrische Anthropologie verkündet, die den Menschen ihre von Christus herkommende Würde zusprach, aber zugleich säkularen und totalitären Allmachtsphantasien ihre Grenzen aufzeigte. Trotz der weltweiten Gültigkeit des neuen Hochfestes ist zu beachten, dass dieses auf dem Staatsgebiet des faschistischen Italiens entstand – die katholische Kirche unterzog ihr Verhältnis zum säkularen Staat angesichts des real existierenden Totalitarismus einer Positionsbestimmung.
In Italien lotete die katholische Kirche Kooperationsmöglichkeiten mit dem Regime Mussolinis in Bereichen gemeinsamen Interesses (z.B. in der Bildungs- und Jugendarbeit) aus, stellte sich aber überall dort dem faschistischen Regime entgegen, wo die freie Ausübung des christlichen Glaubens eingeschränkt oder gar gefährdet wurde. Aus den Vorgängen in Italien lässt sich allerdings keine generelle Bevorzugung totalitärer Bewegungen durch die katholische Kirche schlussfolgern, wie die Ablehnung der Action Française in Frankreich und des Kommunismus sowjetischer Provenienz zeigten. Die drei päpstlichen Enzykliken des Jahres 1937, von denen insbesondere das Lehrschreiben Mit brennender Sorge weltweite Berühmtheit erlangt hat, sind ein deutlicher Beleg dafür, dass sich die Kirche in ihrer ideologiekritischen Zielrichtung gegen alle totalitären politischen Systeme weltweit wandte und im Protest gegen die ideologische Verabsolutierung des Staates auf dem Fundament ihrer Soziallehre die untrennbare Verbindung von Gemeinwohl und Wohl des Einzelnen betonte. Das positive Anliegen der Enzykliken war der Ausdruck der Entschlossenheit der katholischen Kirche unter der Leitung Pius‘ XI., im Zeichen der Königsherrschaft Christi neue missionarische Initiativen zu starten (Stichwort Katholische Aktion), die vor allem von engagierten Laien getragen wurden.
Nur wenige Monate nach der Enzyklika Mit brennender Sorge und mitten in die staatlichen Repressionsmaßnahmen gegen deren Verbreiter setzte die Christkönigsgesellschaft ein religiöses Zeichen, mit dem sie sich in die Opposition der Kirche gegen den Nationalsozialismus einreihte: Die Entscheidung für das Christkönigsfest als neues Hauptfest der Christkönigsgesellschaft ab 1937 bedeutete in den politischen Auseinandersetzungen der NS-Zeit eine deutliche Verweigerung totalitärer Machtansprüche.
Die Christkönigsthematik im Leben und Wirken Metzgers
Max Josef Metzger lebte schon früh aus einer christozentrischen Spiritualität. Die Erfahrung des I. WK im Fronteinsatz am Hartmannsweilerkopf stellte eine wichtige Zäsur in seinem Leben dar: Fortan strebte er danach, in Graz, das von tiefgehenden sozialen und konfessionellen Differenzen und Spannungen geprägt war, die Impulse der Christkönigsverehrung für eine friedliche und demokratische Entwicklung der Gesellschaft im Kontext der Völkerverständigung herauszuarbeiten und in die Tat umzusetzen.
Metzgers Friedensprogramm von 1917, in dem der Aufruf zum Frieden mit der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit verbunden wurde, forderte auf dem Fundament der „Kommunion mit dem Friedenskönig Christus“ die Rückkehr zum Christentum, dessen Grundsätze seiner Meinung nach durch den Krieg verlassen worden waren. 6Metzger bezog sich also bereits während des I. WK – und somit mehrere Jahre vor der offiziellen Einführung des Christkönigsfestes – auf die Glaubensüberzeugung von der Königsherrschaft Christi. Dies führte 1919 zur Gründung des Weißen Kreuzes, einer ordensähnlichen Kommunität. Bereits durch die Namensgebung, die sich auf das Kreuz bezog, das auf die weißen Hostien aufgeprägt war, verwies diese Gemeinschaft auf die eucharistische Grundlegung ihrer Tätigkeit. Mithilfe missionarischer und caritativer Tätigkeiten sollte in universaler Weise möglichst die ganze Welt für das Königtum Christi gewonnen werden.
Als weiterführende Erkenntnis aus den Erfahrungen des I. WK gelangte Metzger allerdings zu der Überzeugung, dass die Konkretisierung universaler Ideen wie die des Friedenskönigtums Christi nur mit gleichgesinnten Menschen in der eigenen Kirche und in der Gesellschaft realisierbar ist. Dies suchte er in den Organisationen Friedensbund deutscher Katholiken (FDK) und Katholische Internationale (IKA), die er beide mitbegründete, in die Tat umzusetzen.
Sein Blick über den Denkhorizont der eigenen Konfession hinaus zeigte sich in seiner Wertschätzung für die protestantisch geprägte Heilsarmee. Bemerkenswert war auch, wie Metzger schon wenige Jahre nach dem Ende des Krieges zu einer friedlichen Verständigung zwischen deutschen und französischen Katholiken beitrug. Metzger radikalisierte seine pazifistischen Überzeugungen, indem er sich für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung engagierte. Unter Rückgriff auf die jesuanische Botschaft der Bergpredigt rief er dazu auf, allen gesellschaftlichen Akteuren, die sich für den Krieg einsetzten, eine Gewissensentscheidung für den Frieden entgegenzuhalten.
Die von ihm gegründete Missionsgesellschaft mit caritativem Schwerpunkt widmete sich der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des sozialen Friedens, indem sie Solidarität mit den Ärmsten der Gesellschaft praktizierte und durch ihre Arbeit dazu beitrug, die infolge des Krieges zunehmend säkularisierte Gesellschaft von neuem mit dem christlichen Glauben in Verbindung zu bringen und zu prägen. Menschen aus den verschiedensten Berufen und sozialen Schichten kamen in der Missionsgesellschaft zusammen, um im Dienst des Königtums Christi in der Gesellschaft zu wirken.
Dieser Dienst schloss auch Gesellschaftskritik mit ein. In den gesellschaflichen Umbrüchen, die Österreich nach dem I. WK durchmachte, sprach sich Metzger für einen „christlichen Sozialismus“ aus, der sowohl kapitalismuskritische Züge trug als auch gegen die religionsfeindlichen Tendenzen eines klassenkämpferischen Kommunismus gerichtet war. Weil Christus nach der Überzeugung Metzgers über den Parteien stand, hielt er sich von parteipolitischem Engagement fern. Zugleich versuchte er, zwischen den konkurrierenden Parteien und der katholischen Kirche Brücken zu bauen – was ihm allerdings den massiven Widerstand von Vertretern der verfeindeten politischen Lager einbrachte.
Читать дальше