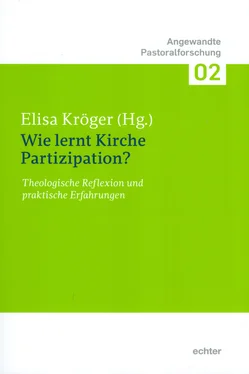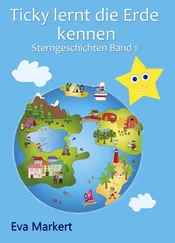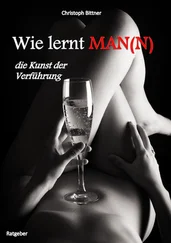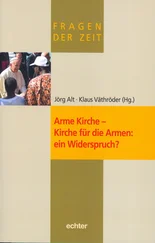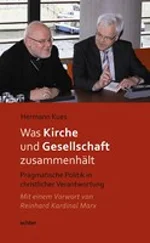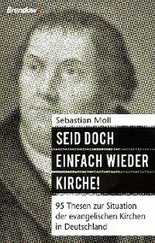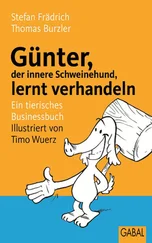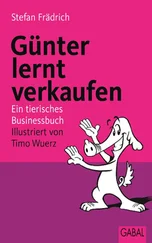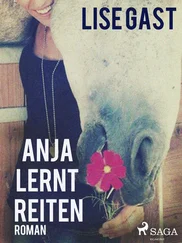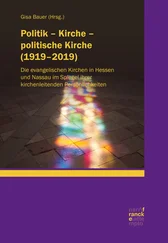3. BEWERTUNG DES PROJEKTERTRAGS
Die hier vorgenommene Projektbewertung findet genau zum Ende des dreijährigen Projekts (1. Mai 2013 – 30. April 2016) statt. Nach einer Vorbereitungsphase mit intensiven Hospitationen der ZAP-Mitarbeiterin an relevanten Orten umfasst die Durchführungsphase vor allem die Erarbeitung, Durchführung und Evaluation von zwei Jahresprogrammen „Verantwortung teilen“ (2. Halbjahr 2014/1. Halbjahr 2015 und 2. Halbjahr 2015/1. Halbjahr 2016). Zunächst einige quantitative Daten: Mit den verschiedenen Kursen der beiden Programme werden in zwei Jahren 149 TeilnehmerInnen erreicht. Diese absolvieren insgesamt 394 Teilnehmertage. Von den TeilnehmerInnen sind 98 freiwillig Engagierte und 51 hauptberuflich Tätige. Es ergibt sich also ziemlich genau ein Verhältnis von 2/3 Ehrenamtlichen zu 1/3 Hauptberuflichen. Fragt man, wie weit das Programm die 71 pastoralen Räume im Bistum Aachen erreicht hat, so lässt sich feststellen, dass insgesamt 15 Gemeinschaften der Gemeinden in Kurse involviert waren, sei es mit ihrem GdG-Rats-Vorstand oder einem „Team besonderer Leitung“ oder auch einem sogenannten „Tandem“ aus je einem hauptberuflich und ehrenamtlich Engagierten. Somit werden 21% der pastoralen Räume durch das Programm erreicht.
Aus der Sicht des Bistums Aachen stellt sich diese quantitative Quote als Erfolg dar. In diese Bewertung fließt ein, dass es in jedem dieser Fälle um gemeinschaftliches Lernen von freiwillig Engagierten und hauptberuflich Tätigen geht, d. h. alle Wege, verpflichtende Teilnahmen zu inszenieren, sind verbaut. Alle Teilnahmen sind Ergebnis von Dialog- und Aushandlungsprozessen vor Ort, in denen sich die Akteure darauf einigen, das Wagnis eines solchen gemeinsamen Lernweges einzugehen. Es ist also bei dieser Art des Lernens keine „hierarchische Steuerung“ denkbar, sondern es kann immer nur um „Kontextsteuerung“ gehen. Damit wird deutlich, dass dort, wo in einem pastoralen Raum die Kommunikation schlecht und die maßgeblichen Akteure entweder miteinander zerstritten oder kaum in Kontakt sind, kein Boden dafür bereitet ist, sich auf eine solche Weiterbildungseinladung einzulassen. Es wird eine Herausforderung für das Bistum Aachen sein, genauer zu evaluieren, welche Bedingungen förderlich sind für die Entscheidung zur Teilnahme, um von da aus zu fragen, wie man an mehr Orten solche Bedingungen schaffen kann.
Mit Blick auf die strategischen Zielsetzungen lässt sich festhalten: Die gewünschte Signalwirkung hat sich eingestellt. Das Label „Verantwortung teilen“ ist im Bistum bekannt, relevante Gremien auf Diözesan- und Regionalebene wie Priesterräte, Pastoralräte, Katholikenräte sind mit dem Programm vertraut. Es ist aus den Evaluationen der TeilnehmerInnen deutlich ersichtlich, dass das Ziel, nicht nur über Partizipation zu reden, sondern im Lernprozess selber Partizipation zu leben, erreicht worden ist. Alle Teilnehmenden, insbesondere aber die aus dem Kreis der freiwillig Engagierten, äußern sich sehr positiv darüber, dass und wie alle Ressourcen und Talente in ihrer Perspektivenvielfalt geschätzt und nicht etwa als Problem betrachtet werden. Im Vollzug ereignet sich so, was von der Anlage her behauptet wird. Die Lernmethoden haben es vermocht, den Sprung von theologischer Theorie in die pastorale Praxis zu schaffen. Eine theologische Zentralchiffre wie das „gemeinsame Priestertum der Gläubigen“ wird so im Fortbildungsvollzug erlebbar, dass es die Teilnehmenden inspiriert, in ihren jeweiligen Arbeitskontexten vergleichbar zu agieren. Die Passgenauigkeit von Inhalten und Methoden der angebotenen Kurse wird wesentlich durch die Mitwirkung des „Zentrums für angewandte Pastoralforschung“ abgesichert. Dies geschieht in der Anfangsphase des Projekts u. a. durch ausführliche Hospitationen sowie Interviews der ZAP-Mitarbeiterin mit relevanten Akteuren im Feld. Es folgt eine qualifizierte quantitative empirische Erhebung bei 21 freiwillig Engagierten in Pfarreien des Bistums, die nach besonderen Leitungsformen geführt werden. Die freiwillig in den Leitungsteams von vier Pfarreien, die nach c. 517 § 2 CIC/1983 geleitet werden, sowie drei weiteren Pfarreien, die nach dem Aachener Konzept der „Gemeindeleitung in Gemeinschaft“ geleitet werden, können u. a. zu erlebten Stärken und Schwächen im ehrenamtlichen Engagement und zu Weiterbildungswünschen antworten. 27Die Ergebnisse ermöglichen es, für diese sieben Leitungsteams passgenaue Fortbildungsbausteine zu entwickeln und in Kursen zu erproben.
Es kann nach drei Jahren konstatiert werden, dass der gesamte Bildungsansatz, um ein Wort von Karl Rahner aufzugreifen, so etwas wie der „Anfang eines Anfangs“ ist. Die Frage der Vertiefung stellt sich ebenso wie die der Nachhaltigkeit. Damit wird das Augenmerk der Bewertung auf das zweite strategische Hauptziel gelenkt, nämlich das gemeinschaftliche Lernen von hauptberuflich in der Pastoral Tätigen, insbesondere aus den vier Seelsorgeberufen, und den in verschiedenen Funktionen freiwillig Engagierten. Insgesamt kann aus den Rückmeldungen geschlossen werden, dass der eingeschlagene Weg sich bewährt hat. Bei genauerer Betrachtung lassen sich Differenzierungen feststellen. Für die sogenannten „Teams besonderer Leitung“ ist die Frage gemeinschaftlichen Lernens schon vorher gelebte Praxis. Sie wird über das Programm „Verantwortung teilen“ vertieft und qualifiziert. Die Tatsache, dass eine qualitativ hochwertige Pastoral heute nur in der Verschränkung professioneller und freiwilliger Perspektive erzielbar ist, steht für diese Gruppen außer Frage. Anders stellt sich das Bild bei den im Kursgeschehen involvierten Vorständen der Synodalgremien auf Ebene der pastoralen Räume dar. Auch hier sind in der Evaluation einhellig die Stimmen sehr angetan vom gemeinsamen Lernweg. Dieser kommt jedoch nicht in allen Fällen komplett zustande, d. h. in Einzelfällen ist es nur teilweise möglich, die hauptberuflich im Vorstand vertretenen Priester, Gemeinde- sowie Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten zur Teilnahme zu bewegen. Als Grund wird meistens die Arbeitsbelastung vor allem am Wochenende genannt. Die Kurse können jedoch wegen der beteiligten Ehrenamtlichen nur am Wochenende stattfinden. Aber es liegen auch Beobachtungen vor, die darauf hindeuten, dass es für die hauptberuflich Tätigen noch nicht selbstverständlich ist, in dieser Verbindlichkeit sich einem gemischten Lernsetting auszusetzen und im konkreten Lernen den viel beschworenen Umgang „auf Augenhöhe“ zu praktizieren.
Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich diese Lernkonstellation weiter entwickelt. Sie führt an den neuralgischen Punkt von eingeübten Mustern getrennten Lernens sowie all den Phänomenen einer auch im Seelsorgedienst hoch professionalisierten Kirche, die mit der Versuchung zu kämpfen hat, dass die Professionellen wegen ihrer fachlichen Expertise und ihres Informationsvorsprungs nicht nur zu wissen glauben, wo es lang gehen soll, sondern den Weg auch gerne mal beschreiten, ohne lange zu fragen. Stellt man auf der anderen Seite die steigenden zeitlichen Beanspruchungen vieler freiwillig Engagierter in Rechnung, so tut sich eine Spannung auf, die der je situativen Aushandlung von Partizipationsgraden und -bereichen bedarf. In Fortführung des Gedankens von Rainer Bucher kann man hier von einer wechselseitigen Abhängigkeit der Professionellen und der Freiwilligen sprechen.
In der Summe kann das Projekt sowohl aus der Perspektive des Bistums Aachen als Projektträger als auch der Teilnehmenden als ebenso notwendige wie erfreuliche Stärkung auf dem Weg hin zu einer Pastoral des Volkes Gottes bezeichnet werden. Die positive Resonanz gibt Schwung. Die konstruktiv-kritischen Hinweise auf dem dreijährigen Weg lenken die Aufmerksamkeit auf Entwicklungspotenziale. Die dezidierte Beteiligung der wissenschaftlichen Theologie in Gestalt des „Zentrums für angewandte Pastoralforschung“ hat sich für die Praxis ausgezahlt. Als Kunde des ZAP hat das Bistum Aachen von dessen Theorieinput ebenso wie von seiner Praxisreflexion profitiert. Das Team der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Zentrums war ein wichtiger externer Resonanzraum für das Aachener Projekt. Seine Fremdwahrnehmung hatte eine korrektive und inspirative Funktion. So vollzog sich im Projektverlauf das, was wissenschaftstheoretisch vom ZAP als Basisverständnis seines Vorgehens grundgelegt ist, nämlich „Pastoraltheologie explizit als angewandte Wissenschaft zu betreiben“ 28. Dies spezifiziert Matthias Sellmann, der Direktor des Zentrums, wie folgt:
Читать дальше