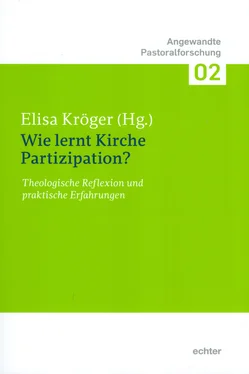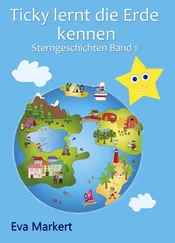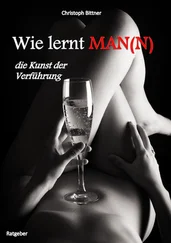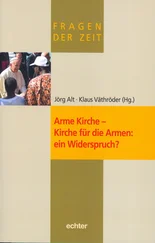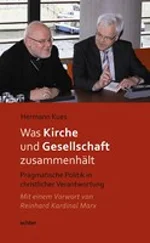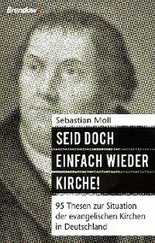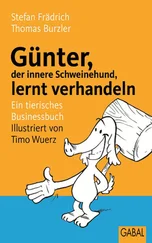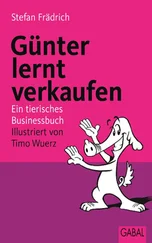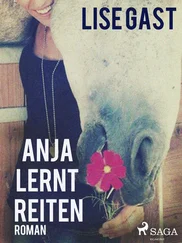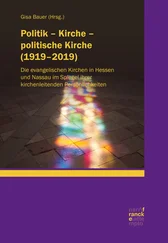Nach dem Motto „Global denken – lokal handeln“ soll der GdG-Rat aus seiner überörtlichen Perspektive beurteilen und entscheiden, was pastoral besser lokal vor Ort anzugehen und umzusetzen ist und was angemessener und wirkungsvoller auf der Ebene des ganzen pastoralen Raums oder in noch einmal existierenden Substrukturen passieren soll. Gemäß dem von Christian Bauer geprägten Wortspiel „Nähe und Weite statt Enge und Ferne“ wahrt die neue Satzung strikt das Subsidiaritätsprinzip und weitet gleichwohl den Blick in eine Raumdimension, die vor allem im städtischen und rand-städtischen Raum eher dem Lebensgefühl und den Bewegungsräumen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen entspricht. 12
1.6 NEUE WEGE GEHEN – GRÜNDEN!
Das bisher skizzierte Profil der bistümlichen Pastoralentwicklung schärfte Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff gegen Ende seiner Amtszeit noch einmal durch die Akzentuierung der Motive des „neuen Wegs“ und des „Gründens“ – und zwar einerseits gegenüber seinen MitarbeiterInnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst:
„Neue Gestalten von Kirche pflanzen, neue Formen von Gemeinschaften und Gemeinden gründen, das scheint mir tatsächlich ein Gebot der Stunde zu sein. Über das Wachsen entscheidet Gott – aber schaffen wir das, eine neue ‚Gründerphase‘ einzuläuten? […] Wir brauchen aber eine neue Balance zwischen der Verteilung von Phantasie, Energie und Zeit auf den Kanon von Grunddiensten einerseits und auf Aufbrüche andererseits.“ 13
Andererseits auch gegenüber den gewählten Pfarrgemeinderäten im Bistum:
„In dem Maße, wie wir das Taufbewusstsein aufbauen, können wir falschen Klerikalismus abbauen. Damit meine ich nicht nur den Klerikalismus, der manche Priester oder andere beauftragte Seelsorgerinnen und Seelsorger zuweilen meinen lässt, jenseits ihrer Kontrolle dürfe nichts passieren. Mit Klerikalismus meine ich auch die allzu schnelle Bereitschaft mancher Getauften, die eigene Verantwortung als Christ oder Christin an die ‚Profis‘ und die ‚Pastoralexperten und -expertinnen‘ abzugeben. Wir brauchen ein neues Zutrauen in die Wirkmacht unserer Taufe und als logische Konsequenz ein neues Vertrauen in die Gaben und Talente der Anderen, die ja auch von Gott Begabte und Berufene sind!“ 14
Da bloße Appelle nicht reichen, hat das Bistum Aachen für die Berufseinführung ihrer Seelsorgeberufe und für deren Fortbildung das sogenannte „Aachener Gründertraining für Seelsorgerinnen und Seelsorger“ entwickelt, das 2017 zum dritten Mal durchgeführt wird. In diesem Training wird ganz konkret gefragt und eingeübt, wie das in der pastoralen Praxis umgesetzt werden kann, was der Bischof anmahnt:
„Ich stehe dafür, dass wir neue Wege beschreiten, dass wir nicht nur Vertrautes verwalten, sondern Neues gründen. Ich stehe dafür, dass wir lernen, fehlerfreundlicher zu werden und die honorieren, die sich mutig auf den Weg machen, auch wenn sie manchmal in einer Sackgasse stecken bleiben. Das ist allemal besser als vor lauter Ängstlichkeit und Sorge immer nur etwas zu konservieren, dessen Zeit eigentlich abgelaufen ist. Sterben gehört zum Leben. Es ist aber auch ein Gesetz des Lebens, dass immer wieder Neues sprießt.“ 15
Die bischöfliche Ermutigung mag das Eine sein – das Andere ist es, die apostrophierten „neuen Wege“ vor Ort auch gegen etwaigen Widerstand beharrlich zu gehen. Das Rückgrat des Einzelnen und die persönliche Initiative der Einzelnen sind unabdingbar, für ehrenamtlich Engagierte wie für hauptberuflich Tätige. Ebenso unverzichtbar ist die Spiritualität des langen Atems. Aber im Bistum Aachen dürfen diejenigen, die mutig neue Kirchengestalten anvisieren, ihren Bischof hinter sich wissen.
2. DIE STRATEGISCHE FUNKTION DES PROJEKTS „VERANTWORTUNG TEILEN“ IM DUKTUS DER DIÖZESANEN PASTORALENTWICKLUNG
Mit dem Projekt „Verantwortung teilen“ soll ein Meilenstein gesetzt werden. Ein sowohl äußeres als auch inhaltliches Signal dafür ist die Einbindung des „Zentrums für angewandte Pastoralforschung“. Das ZAP soll nicht nur für fachliche Seriosität stehen, sondern insgesamt Glaubwürdigkeit vermitteln: Das Bistum meint es ernst! Verantwortung soll wirklich neu gedacht und dann auch in neuartiger Weise praktiziert werden. Dafür steht auch die finanzielle Investition, von der Anstellung der Mitarbeiterin bis hin zu einem hochwertigen Kursangebot für ehrenamtlich Engagierte, das für diese kostenfrei ist. Die von außen hinzukommende „Fremde“, d. h. die wissenschaftliche Mitarbeiterin des ZAP, die nun drei Jahre lang immer wieder im Bistum auftaucht – bei Akteuren vor Ort, in diözesanen Gremien, bei Kursen und Veranstaltungen – personifiziert zusätzlich diesen „spirit of change“. Fern der Illusion, ein Projekt dieser Art könne Welten bewegen, lebt die Strategie des Projekts auch von dieser seiner Signalwirkung. Inhaltlich geht es um zwei strategische Hauptstoßrichtungen des Projekts und Bildungsprogramms „Verantwortung teilen“:
(a) Das erste und zentrale strategische Ziel ist es, mit relevanten Akteuren in möglichst vielen pastoralen Räumen einen bestimmten theologischen, pastoralen und pädagogischen Lernweg zu intensivieren und zu konkretisieren. Die leitenden inhaltlichen Linien für diesen Lernweg erschließen sich aus den vorigen Kontextualisierungs-Hinweisen:
– echte Weggemeinschaft mit den Menschen im Sinne des konziliaren Communio-Gedankens intensivieren;
– zu einer wirklichen „Pastoral im Plural“ ermutigen, die sich die Themen von den Lebensfragen der Menschen im Raum geben lässt, bei gleichzeitigem Blick für die Tiefenstruktur von Katholizität;
– angesichts radikalen gesellschaftlichen und kirchlichen Wandels neu nach der eigenen „mission“, der Sendung fragen;
– gut und lange genug hinhören und sich dabei bewusst auch fremden Lebenswelten aussetzen;
– daraus, wo es angezeigt ist, mit den Menschen bedarfs- und bedürfnisorientiert vermehrt neuartige oder bisher unbekannte Gestalten und Präsenzformen von Kirche entwickeln bzw. gründen.
Das Bildungsprogramm „Verantwortung teilen“ soll dabei so etwas wie der Antriebsriemen beim Motor sein: Es soll die Kraft des „inneren Motors“ tatsächlich „auf die Straße bringen“. Seit Jahren besprechen wir ausführlich die theologischen Topoi des gemeinsamen Priestertums und der Taufwürde, der Charismen und der Berufung. Es gibt viel neues Potenzial im Motor. Aber was ist mit der Kraftübertragung? Wie kommt die Energie auf die „Straße“? Wie findet die richtige (neue) Theorie ihre Praxis? Wenn die neue theologische Kraft wirken soll, muss sich der Leitungsstil in Gremiensitzungen ebenso ändern wie die Anlage der Sakramentenkatechese, bekommen diakonische Initiativen ein anderes Gepräge und Liturgien einen neuen Stil. Der Schritt von der Theorie in die Praxis fällt oft schon allein deswegen erkennbar schwer, weil neue Methoden, die der neuen Theologie entsprächen, nicht bekannt bzw. eingeübt sind.
Der Schritt von der Theorie in die Praxis ist aber vor allem ein Schritt vom „Kopf“ in den „Bauch“. Damit wird ein höchst sensibler Aspekt thematisiert, nämlich das Terrain eines langjährig erlernten und biographisch gefestigten Habitus. Theologisches Ringen um eine Pastoral der Berufung, der Achtung der Taufwürde und der geteilten Verantwortung ist zunächst Auseinandersetzung auf der Sachebene. Sie wird mit Argumenten geführt, erzeugt mal Plausibilität, mal Dissens. Aber wie kann sie kulturprägend werden? Wie kann sie einwirken auf die Ebene, die es mit erworbenen Haltungen und Einstellungen zu tun hat? Christian Hennecke sagt mit Blick auf einen neuen Umgang mit Verantwortung in Kirche und Gemeinde: „Vielmehr zeigen sich die Konstitution von örtlichen Gemeinden […] und die Bildung örtlicher Verantwortlichkeit als Spitzen eines Eisbergs: Unter Wasser verbirgt sich ein Prozess des Paradigmenwechsels einer kirchlichen Kultur.“ 16Das Paradigma wechseln zu sollen, irritiert den erworbenen Habitus. Pierre Bourdieu versteht unter „Habitus“, wie man sich allgemein gegenüber der Welt verhält. 17„Ein und derselbe Habitus drückt allen Lebensbereichen einen typischen Stempel auf, hinterlässt immer die gleiche Handschrift.“ 18– und zwar langfristig:
Читать дальше