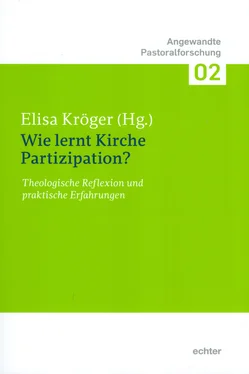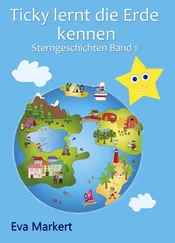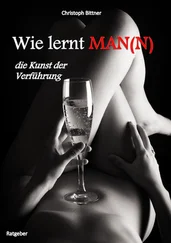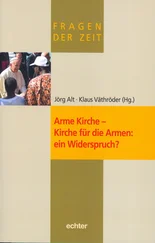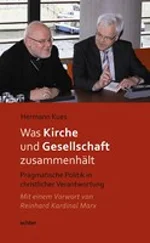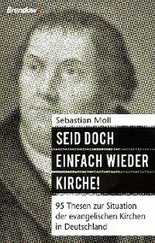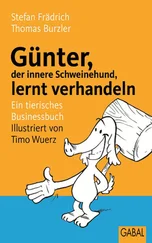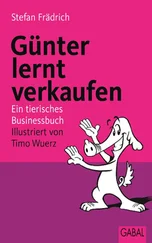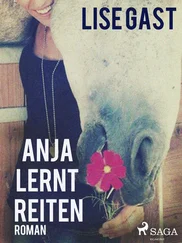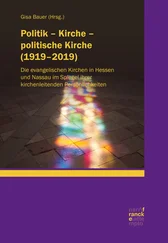Gehorsam gegenüber jeglicher kirchlichen Obrigkeit wurde spätestens im 19. Jahrhundert geradezu zum Ausweis des Katholischen. Das geschah kompensatorisch zur realen Entmachtung der katholischen Kirche im modernen bürgerlichen Staat und zur beginnenden Freisetzung zu religiöser Selbstbestimmung in der liberalen bürgerlichen Gesellschaft. Das I. Vatikanum fordert 1871 in „Dei filius“, dass der Mensch sich „dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft“. Der Wille Gottes aber ist in diesem Konzept grundsätzlich und in allen Details (nur) der kirchlichen Obrigkeit bekannt. Ihr gebührt daher der Gehorsam des „Willens und des Verstandes“. Das Lehramt legt vor, was zu glauben, und legt fest, wie zu leben ist. Es entwickelte sich schließlich, im gewissen Sinn als letzter Rest von Freiheitsspielräumen, ein ganzes System der unterschiedlichen Verpflichtungsgrade kirchlicher Lehren und Gebote. Der dominante Modus der Partizipation war Gehorsam, zumindest offiziell. Dass die Volksfrömmigkeit spezifische Spielräume einbaute, war dabei eher integrationsfördernd.
Zentrales Merkmal des Klerikalismus der Pianischen Epoche war die mehr oder weniger selbstverständliche Unterordnung der privaten Lebensführung seitens der katholischen Laien unter die klerikal-kirchliche Richtlinienkompetenz bis hinein in die privatesten Praktiken 14, inklusive der (nur mehr: innerkirchlichen) Deutungskompetenz über Wissenschaft und Gesellschaft. Das Verhältnis von Klerikern und Laien war das Verhältnis von Führung und Gehorsam. So zumindest forderte man es und konnte man es auch in spezifischen gesellschaftlichen und lokalen Regionen noch durchsetzen. Das sollte einerseits gegen die moderne liberale Gesellschaft immunisieren, war aber andererseits auch anschlussfähig an die anti-liberalen, autoritären Strömungen vor und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg.
Natürlich gab es seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine zunehmende Aufmerksamkeit auf das „Laienapostolat“, in Österreich in Form der „Katholischen Aktion“, in Deutschland als „Katholische Verbände“. Begründet wurde dieses Laienapostolat übrigens schon damals damit, dass die eigentlichen „Seelsorger, schon zahlenmäßig, aber auch was die Problematik und die Fülle der Arbeit betrifft, vor Aufgaben“ stünden, „deren sie allein nicht Herr werden können“ 15.
II. DEKONSTRUKTIONEN
Nun war die katholische Kirche schon immer eine äußerst komplexe Wirklichkeit und sie ist es heute natürlich noch viel mehr. Es spricht viel dafür, dass die katholische Kirche in einer ausgesprochen dekonstruktiven Situation ist. Dekonstruktion meint literaturwissenschaftlich, einen Weg zwischen hermeneutischer, tendenziell konservativer Verstehensgewissheit und progressiver Kritiksicherheit zu suchen. Übertragen auf Phänomene jenseits von Texten geht es um die nicht mehr länger abweisbare Erfahrung eines erlittenen, außen-, nicht selbstgesteuerten Umbaus, der Altes zerstört, aber auch Neues schafft, freilich ohne dass dieses Neue das unmittelbar intendierte Ergebnis der Planungen und auch nur schon wirklich hinreichend bekannt ist. Eine Mischung aus Erleiden, Erfahren und tastendem Gestalten charakterisiert dekonstruktive Situationen, inklusive der Erfahrung der Stabilität genau dieser fragilen und fluiden Situation. Es geht dann um die Suche „nach Wegen, in den Ruinen zerbrochener Machtsysteme zu wohnen“ 16. Ruinen aber fehlt der (ursprüngliche) Zusammenhang, der noch ahnbar, ja „sichtbar“ ist, aber nicht mehr funktioniert. Zudem fehlt Ruinen das Dach: Sie konstituieren zwar noch einen eigenen Raum, sind aber zugleich Elemente „unter freiem Himmel“.
Das ehemals ausgesperrte oder nur kontrolliert zugelassene Außen ist nun permanent sichtbar, es dringt ein und überhaupt vieles dringt ein. Das eröffnet Weite, was jene begrüßen, die sich immer schon eingesperrt fühlten, vermittelt aber auch Schutzlosigkeit, was jene fürchten, die Schutz und Sicherheit suchten. Ruinen künden von vergangener Größe, schaffen aber auch eine Landschaft von unbestreitbarem Reiz, sie sind an ihrem alten Ort, kontextualisieren aber alles völlig neu. Es gibt manches vom Alten noch, aber es ist nicht mehr dasselbe, manches funktioniert noch in ihnen, aber nichts mehr wie früher. Wer es sich in ihnen bequem macht, so malerisch sie sind, wird vor allem eines spüren: Sie bieten keinen Schutz mehr, zumindest keinen selbstverständlichen. „Partizipation“ wird unter den dekonstruktiven Bedingungen der kirchlichen Gegenwart radikal transformiert. Sie wird von einer Zulassungsgnade der Obrigkeit zu einer Aktivierungsnotwendigkeit des Systems. Denn in Ruinen hält nichts Äußeres mehr zusammen, muss eine interne Kohäsion gefunden werden, will man sich nicht verlieren.
Nachdem sich die Machtverhältnisse zwischen Individuum und religiösen Institutionen auch im katholischen Feld fundamental gedreht haben und sich auch die katholische Kirche situativ und nicht mehr normativ vergemeinschaftet 17, gerät die klassische katholische Pastoralmacht in ihre finale Krise. Es findet aktuell nichts weniger als die Verflüssigung der Kirchen als religiöse Herrschaftssysteme, als mächtige Heilsbürokratien, als die sich vor allem die katholische Kirche in der Pianischen Epoche verstand und formatierte, statt. 18Ohne die eigene Basis und deren pluralen Umweltkontakt verirrt sich solch ein System im Nirwana seiner defizitorientierten Selbstbespiegelung und in der mehr oder weniger gelungenen Aufarbeitung seiner Demütigungserfahrungen in einer Zeit, die Religion zwar nicht verabschiedet, aber dramatisch in ihrer Relevanz mindert. 19Es fällt immer noch vielen in der katholischen Kirche schwer, das zu akzeptieren. Auch Teile des Partizipationsdiskurses scheinen noch von einem gewissen hoheitlichen Zulassungsgestus geprägt. Das verwundert nicht: Das kollektive Gedächtnis der katholischen Kirche erinnert vor allem Machtkompetenzen, das Christentum ist es schließlich seit der „Konstantinischen Wende“ des 4. Jahrhunderts gewohnt, sich über gesellschaftliche Herrschaftsprozesse zu realisieren und hat auch sein eigenes Theoriegebäude in hohem Maße „konstantinisch“ formatiert. 20Zwar hat in Deutschland der organisierte Laienkatholizismus als Verbands- und Politischer Katholizismus eine lange und durchaus eindrucksvolle Geschichte, so wurde nach der Würzburger Synode eine Rätestruktur auf allen kirchlichen Ebenen installiert, das pastorale Laienamt des Pastoralreferenten/der Pastoralreferentin eingeführt und überhaupt das nicht-klerikale professionelle Personal massiv ausgeweitet. Und doch: All dies führte vielleicht zu einer gewissen Änderung der Kommunikationskultur zwischen Laien und Priestern, nicht aber zu einem wirklichen neuen pastoralen Paradigma. Die kirchliche Rätestruktur etwa wird nicht zuletzt durch mangelnde Relevanzvermutung und Relevanzerfahrung seitens des Volkes Gottes 21ausgehöhlt, dies signalisieren zumindest die Partizipationszahlen an den entsprechenden Wahlen. Signifikante Orte öffentlicher kirchlicher Laienaktivität wie etwa die Laienpredigt 22wurden zudem wieder eliminiert, selbst die aktuellen kirchenrechtlichen Spielräume zur Gemeindeleitung durch Laien werden nicht oder nur zögerlich ausgenutzt. 23Selbstverständlich gibt es bei einzelnen dieser Punkte auch gegenläufige Entwicklungen in einzelnen deutschsprachigen Diözesen, sie differenzieren den Gesamtbefund, ändern ihn aber nicht grundlegend.
III. ASYMMETRIEN
Jene Sozialform der katholischen Kirche, wie sie sich nach dem Konzil von Trient (1545 bis 1563) in Reaktion auf den beginnenden Reichweitenverlust kirchlicher Pastoralmacht gebildet hatte, zerfließt in den Kontexten einer spätmodernen Gesellschaft. Man kann davon ausgehen, dass die Zukunft der katholischen Kirche in unseren Breiten nicht primär von der Verfügbarkeit diverser Ressourcen, auch nicht von ihrer konkreten Organisationsform vor Ort, sondern von der Transformation zentraler, für die katholische Kirche typischer asymmetrischer Kontraste abhängt.
Читать дальше