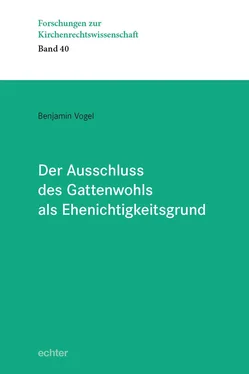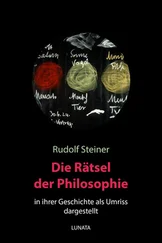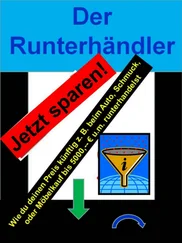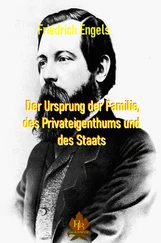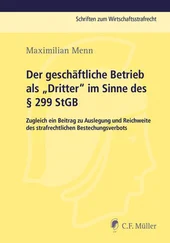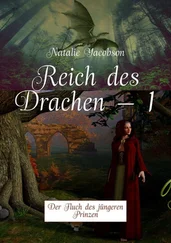Der endgültige Text des Kapitels über die Ehe umfasst sechs Artikel: Zunächst stellt GS 47 die fundamentale Bedeutung von Ehe und Familie für das Wohl der Person und der ganzen Gesellschaft fest, bevor einzelne Gefährdungen (bspw. Polygamie oder Egoismus) für die Würde dieser Institution aufgezählt werden. Die Lehre des Konzils versteht sich demgegenüber als Stärkung für die von diesen Problemen betroffenen Menschen. GS 48 beschreibt die Ehe in schöpfungstheologischer und soteriologischer Hinsicht. 60Gott wird als Urheber dieser „innige[n] Gemeinschaft des Lebens und der Liebe“, vorgestellt, die auch als Bund, als Ort inniger Verbundenheit und als „gegenseitiges Sich-Schenken zweier Personen“ beschrieben wird und als Sakrament die Eheleute stärkt. Die beiden Artikel 49 und 50 befassen sich mit der Bedeutung der Liebe bzw. der Fruchtbarkeit für die Ehe. Die Liebe umgreift die gesamte Wirklichkeit der ehelichen Gemeinschaft und kennt verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Diese eheliche Liebe und die Ehe sind auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommen hingeordnet, Kinder werden als „vorzüglichste Gabe für die Ehe“ verstanden, doch wird explizit erklärt, dass auch eine kinderlose Ehe ihren Wert behalte. Die Aufgabe der Elternschaft sollen die Partner verantwortet und im Hören auf das eigene Gewissen wahrnehmen. GS 51 führt diesen letzten Gedanken weiter und hebt hervor, dass bei der Geburtenregelung nicht auf unsittliche Methoden zurückgegriffen werden dürfe. 61Mit Aussagen über die Erziehung der Kinder und einem Appell an alle Menschen, sich für den Schutz und die Förderung der Familie einzusetzen, schließt Artikel 52 das Ehekapitel der Pastoralkonstitution ab.
In Bezug auf das Verhältnis der Sinngehalte der Ehe ist von Bedeutung, welche Rolle die Konzilsväter der ehelichen Liebe ( amor coniugalis ) zuschreiben: Nach der Charakterisierung der ehelichen Gemeinschaft in GS 48 wird in den beiden folgenden Artikeln zuerst die eheliche Liebe und dann die Fortpflanzung behandelt. Ebenso wird die Liebe in eine Reihe mit der Fortpflanzung, der Einheit und der Treue gestellt. 62Die Parallelisierung von Liebe und Nachkommenschaft begegnet auch in GS 51. 63Solche Textstellen vermitteln den Eindruck, dass mit der Liebe ein eigenständiger Sinngehalt der Ehe neben der Fortpflanzung ausgedrückt werden sollte.
Doch es ist eine andere Verwendungsweise des Liebesbegriffs, die das Ehekapitel dominiert: 64So wird bereits zu Beginn von GS 48 mit der Liebe nicht nur ein Teilaspekt, sondern die gesamte Wirklichkeit der Ehe definiert. 65Derselbe Artikel handelt vom Segen Christi über die Liebe, womit auch an dieser Stelle die Ehe als Ganzes gemeint ist. 66Zweimal tritt die Liebe als Subjekt neben der Ehe auf, wenn erklärt wird, dass Ehe und Liebe auf Nachkommenschaft hingeordnet seien. 67An diesen Aussagen wird erkennbar, dass die eheliche Liebe nicht als ein bloßer Teilaspekt der Ehe verstanden wird, sondern die ganze Wirklichkeit der Ehe betrifft und beschreibt. Norbert Lüdecke sieht daher in der Liebe das „Strukturprinzip der gesamten Ehewirklichkeit“ und den „kontinuierliche[n] Referenzpunkt des ganzen Ehekapitels.“ 68
Die widersprüchliche Beschreibung des amor coniugalis als eigenständiger Sinngehalt neben der Fortpflanzung einerseits und als ein die ganze Ehe durchdringendes Strukturprinzip andererseits liegt darin begründet, dass während des Konzils noch keine klare Terminologie für einen partnerschaftlichen Sinngehalt zur Verfügung stand. 69Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Konzilstext neben dem prokreativen Sinngehalt ein selbständiger personaler Wert ausgedrückt werden sollte. Das wird sehr anschaulich in GS 48: Die Ehe wird hier vorgestellt als „innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe“, als ein „heilige[s] Band“, das „im Hinblick auf das Wohl der Gatten und der Nachkommenschaft sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht mehr menschlicher Willkür“ unterliege. 70Als dem Zugriff des Menschen entzogen werden demnach nicht mehr nur die Wesenseigenschaften der Ehe, Einheit und Unauflöslichkeit, sowie die prokreative Ausrichtung der Ehe betrachtet, sondern auch das Wohl der Gatten und das Wohl der Gesellschaft. 71Weiter heißt es, die Ehe sei „mit verschiedenen Gütern und Zielen ausgestattet“, die „von größter Bedeutung für den Fortbestand der Menschheit, für den persönlichen Fortschritt der einzelnen Familienmitglieder und ihr ewiges Heil; für die Würde, die Festigkeit, den Frieden und das Wohlergehen der Familie selbst und der ganzen menschlichen Gesellschaft“ 72seien. Auch hier ist der Bezug zur Nachkommenschaft gegeben, gleichzeitig wird jedoch ausführlich die Wichtigkeit für die einzelnen Personen beschrieben und dieser Zusammenhang – allerdings nicht im Sinne einer Rangfolge – von der prokreativen Dimension abgesetzt. 73Die Güter und Ziele „lassen sich sowohl textgeschichtlich als auch in bezug auf die offizielle Endfassung des Ehekapitels textanalytisch als die beiden neben den Wesenseigenschaften der Einheit und Unauflöslichkeit bestehenden Werte der Partnerschaft und der Nachkommenschaft identifizieren.“ 74Diese Werte werden mit den beiden folgenden Sätzen jeweils konkretisiert: Zunächst beschreibt die Konstitution die natürliche Hinordnung der Ehe und der Liebe auf Nachkommen, die als „Krönung“ angesehen werden. 75Danach wird die partnerschaftliche Dimension durch das biblische Bild des Ein-Fleisch-Werdens näher bestimmt. 76Die Gatten sind aufs Engste miteinander verbunden, bestreiten gemeinsam ihr Leben und „erfahren und vollziehen dadurch immer mehr und voller das eigentliche Wesen ihrer Einheit.“ 77Diese eheliche Partnerschaft, die „Lebenseinheit der Ehegatten“ 78wird nicht als Nebenzweck zur Fortpflanzung verstanden, sondern stellt einen „Wesenszug der Ehe“ 79dar. Es geht hier um die Intersubjektivität der Partner und um die Bereicherung, die sie aus dem täglichen Miteinander erfahren. 80
Anschließend werden aus beiden Sinngehalten – und zwar gleichermaßen aus dem partnerschaftlichen wie dem prokreativen – die Wesenseigenschaften der Ehe abgeleitet: Treue und unauflösliche Einheit der Partner liegen in der Vereinigung und der Selbstschenkung der Gatten ebenso begründet wie im Wohl der Kinder. 81Die traditionelle Herleitung der Wesenseigenschaften allein aus dem bonum prolis wird damit überwunden. 82Auch daran lässt sich ablesen, dass die Konzilsväter eine Gleichrangigkeit zwischen beiden Werten vertreten. 83GS 48 schließt mit dem Auftrag an die Ehepartner und die ganze Familie, Zeugnis für das Wirken Christi abzulegen. Erreicht werden soll das „durch die Liebe der Gatten, in hochherziger Fruchtbarkeit, in Einheit und Treue“ 84und durch die Kooperation der Familienmitglieder. Liebe ist hier wiederum nicht Synonym für die Ehe als Ganzes, sondern drückt den partnerschaftlichen Wert aus. Entscheidend ist, dass partnerschaftlichem und prokreativem Wert in gleicher Weise Zeugnischarakter zugeschrieben wird. 85
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Konzilsväter in GS 47–52 die im CIC/1917 normierte und später lehramtlich wiederholt eingeschärfte Unterscheidung zwischen dem Primärzweck der Zeugung und Erziehung von Nachkommen und den Sekundärzwecken der gegenseitigen Hilfe bzw. dem Heilmittel gegen die Begierlichkeit aufgeben. Stattdessen etablieren sie neben dem prokreativen Sinngehalt der Ehe einen diesem gleichwertigen und eigenständigen partnerschaftlichen Sinngehalt. Die Verbindung der Ehepartner wird nicht länger in erster Linie als Gemeinschaft zur Fortpflanzung gesehen, sondern als gleichermaßen von beiden Werten geprägter Liebesbund. Dies lässt sich – trotz begrifflicher Unschärfen im Endtext – anhand der Textgeschichte aufzeigen. Beide Sinngehalte gehören zum Wesen der Ehe, zwischen ihnen besteht eine Balance und nicht eine Rangfolge. 86Insofern ist die konziliare Lehre auch eine Absage an ehetheologische Entwürfe, die der Paarbeziehung als solcher einen Vorrang vor der Fortpflanzung einräumten. 87Dass die Konzilsväter bewusst auf eine juristische Terminologie verzichteten, bedeutet indes nicht, dass mit dem Ehekapitel der Pastoralkonstitution keine verbindlichen Aussagen getroffen wurden. 88Vielmehr enthalten alle Konzilsbeschlüsse, auch das Ehekapitel von Gaudium et spes , „Grundsatzentscheidungen oder Fundamentalprinzipien“, die zwar rechtlich noch zu konkretisieren sind, aber die bereits eine Position bestimmen, „hinter welche die Kirche nicht zurück kann und will.“ 89Tatsächlich hat die konziliare Rede von einem eigenständigen partnerschaftlichen Sinngehalt der Ehe im CIC auch eine rechtliche Konkretion erfahren.
Читать дальше