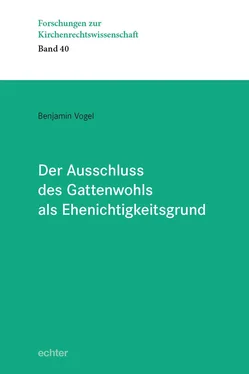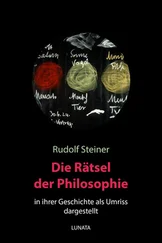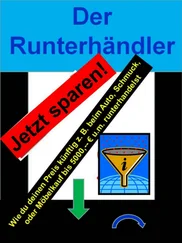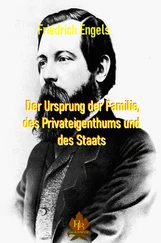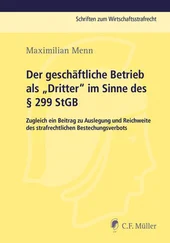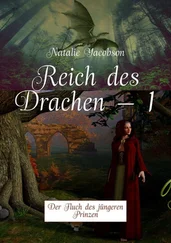Auch der Berliner Jesuit Hermann Muckermann bejahte die Bedeutung der personalen Dimension neben der prokreativen, nahm die Verhältnisbestimmung jedoch anders vor als die beiden zuvor genannten Autoren. Er ging von einem doppelten Sinn der Ehe aus 28und sah die „unmittelbare Aufgabe“ des ehelichen Zusammenlebens darin, „aus der Ergänzungsfähigkeit heraus durch den seelischen Austausch die Entwicklung zu einem höheren Menschentum zu erreichen“ 29. Die Zeugung und Erziehung von Nachkommen seien diesem Sinngehalt jedoch nicht gleich-, sondern übergeordnet: Er betonte, dass „der tiefste Sinn der Ehe nicht nur in der Lebensgemeinschaft von Gatte und Gattin [liege], sondern vor allem in der ehelichen Fruchtbarkeit .“ 30Die Ergänzung der Partner könne erst dann als vollkommen betrachtet werden, wenn ein Kind aus der Ehe hervorgehe. 31Zusammengefasst bestehe die Ehe
„ganz allgemein in der Ergänzung der beiden geschlechtlich verschiedenen Menschen, um der gegenseitigen Vervollkommnung zu dienen und die gesamte Lebensaufgabe – jeder auf seine Art – gemeinsam zu lösen. Dieser allgemeine Sinn, den als solchen auch der römische Katechismus anerkennt, schließt den zweiten Sinn ein, der, von der Natur sowohl als von der Übernatur aus gesehen, der wichtigste ist. Man bezeichnet ihn als finis primarius. Dieser Sinn betrifft das Kind, und zwar seine Entstehung und seine Gestaltung und Erziehung […].“ 32
Auch hier ergibt sich aus der Anerkennung des Eigenwerts der Paarbeziehung keine Konsequenz in rechtlicher Hinsicht.
Die damaligen Versuche stimmen im Bemühen überein, die traditionelle Engführung auf den Fortpflanzungszweck durch die Würdigung eines eigenständigen personalen Zieles zu überwinden. Neben diesem Anliegen waren die Autoren bestrebt, eine Anschlussfähigkeit an die lehramtlichen und kodikarischen Vorgaben zu bewahren. Damit lässt sich auch der Verzicht auf rechtliche Folgerungen erklären. Ferner ist zu beachten, dass die Autoren einen genuin sakramenten- bzw. moraltheologischen Ansatz verfolgten; daher standen Grundlegung und Darstellung des Ehelebens im Vordergrund und nicht die Anforderungen an den Ehewillen. 33
Dennoch sah sich das kirchliche Lehramt zu Klarstellungen veranlasst: In seiner Ansprache vor dem Apostolischen Gericht der Rota Romana vom 03.10.1941 verurteilte Papst Pius XII. die Auffassung, Primär- und Sekundärzweck seien „ugualmente principale“. 34Der Sekundärzweck dürfe zwar nicht bestritten werden, doch sei er dem Primärzweck wesentlich unter- und seiner intrinsischen Struktur nach auf diesen hingeordnet. 35Das Hl. Offizium mahnte dies in einem von Pius XII. approbierten Dekret vom 30.04.1944 ebenfalls an. Anstoß gaben nicht näher genannte Veröffentlichungen, welche verneinten, dass die Zeugung von Nachkommen den Primärzweck darstelle, oder die Unterordnung der Sekundärzwecke unter den Primärzweck ablehnten. 36Exemplarisch wird die Behauptung angeführt, die Ehe sei vorrangig zur persönlichen Ergänzung und Vervollkommnung der Partner eingerichtet. 37Weil aus solchen Ansichten Irrtümer und Unsicherheiten entstehen könnten, sah sich die Kongregation veranlasst, einzuschärfen, dass diese Positionen nicht geduldet werden könnten. 38Pius XII. wiederholte das in mehreren Ansprachen, besonders deutlich und mit ausdrücklicher Berufung auf das Dekret des Hl. Offiziums in seiner Ansprache bei der Versammlung der katholischen Hebammen Italiens vom 29.10.1951. 39Obwohl das kirchliche Lehramt die personale Dimension der Ehe in den o. g. Lehrschreiben anerkannte, betonte es, diese sei vom Fortpflanzungszweck abhängig und ihr komme rechtliche Bedeutung nicht zu. Insofern wurde den ehe- und moraltheologischen Vorstößen, die Ehezwecklehre zu modifizieren, eine klare Absage erteilt. Eine Weiterentwicklung der Ehetheologie, die der Paarbeziehung einen Eigenwert einräumte, und das lehramtliche Beharren auf der Hierarchie der Ehezwecke standen einander unversöhnlich gegenüber.
Der italienische Kanonist Arturo C. Jemolo zeigte an einem fiktiven Fall eindrücklich die Diskrepanz zwischen dem personalen Eheverständnis und der damals geltenden Rechtslage auf: In diesem Beispiel will ein Mann eine Frau mit dem Ziel heiraten, an ihrer Familie Rache zu nehmen. Er hat vor, seine Braut in der Ehe zu quälen, um so deren Familie leiden zu lassen und sie zu demütigen. Wie war ein solcher Ehewille nach der Rechtslage des CIC/1917 zu beurteilen? Jemolo konstatierte: Solange der Mann nicht durch positiven Willensakt eines der drei augustinischen Ehegüter oder die gegenseitige Übertragung des Rechts auf zeugungsgeeigneten Geschlechtsverkehr ( ius in corpus ) ausschlösse, wäre der Ehewille in rechtlicher Hinsicht ausreichend, um eine gültige Ehe einzugehen. 40Das wäre sogar dann der Fall, wenn der Mann darüber nachdächte, seine Braut zu töten. 41Technisch gesehen, würde es sich um eine gültige Ehe handeln, doch sei gleichermaßen klar, dass es sich bei dieser Heirat zur Erfüllung einer vendetta um etwas handle, das keinesfalls dem entspreche und dessen würdig sei, was gemeinhin als Ehe angesehen werde. 42
2.2 Sinngehalte der Ehe in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes
Die lehramtlichen Zurückweisungen neuer ehetheologischer Entwürfe vermochten weder die Diskussion um das Zueinander der Sinngehalte der Ehe gänzlich zu unterbrechen, noch boten sie eine Lösung für das zugrundeliegende Problem. 43Der Fragenkomplex wurde im Kontext der Vorbereitungen und Beratungen des II. Vatikanischen Konzils (1962–1965) erneut behandelt und kontrovers diskutiert.
Bei seiner Ansprache zur feierlichen Eröffnung des Konzils vom 11.10.1962 warnte Papst Johannes XXIII. vor einer negativen Sicht auf den Verlauf der Geschichte und rief die Konzilsväter dazu auf, die Aufmerksamkeit nicht nur auf die kirchliche Überlieferung, sondern auch auf die Entdeckungen und Bedürfnisse der Gegenwart zu richten. 44Das so verstandene aggiornamento im Sinne einer Inkulturation der Offenbarung im Dialog mit der Gegenwart sollte zu einem Leitmotiv des Konzils werden. 45Besonders deutlich tritt dieses Grundanliegen in der „Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute“ Gaudium et spes hervor: Bereits in der Überschrift des ersten Artikels wird die „engste Verbundenheit der Kirche mit der ganzen Menschheitsfamilie“ 46ausgesagt. Die Kirche steht der Welt nicht einfachhin als (be-)lehrende Institution gegenüber, sondern ist innigst ( intima ) mit ihr verbunden und von ihr betroffen. 47Nach dieser programmatischen Einleitung entfaltet die Konstitution eine christliche Anthropologie, auf deren Basis sie wichtige Einzelfragen des menschlichen Lebens erörtert, darunter auch die „Förderung der Würde der Ehe und der Familie“ 48.
Das Ehekapitel in der jetzt vorliegenden Gestalt hat eine bemerkenswerte Vorgeschichte. 49
In den ersten Entwürfen wurde noch an der Hierarchie der Ehezwecke festgehalten: So bekräftigte bspw. das Schema De castitate, virginitate, matrimonio, familia vom 07.05.1962 die Vorrangstellung des Primärzwecks der Zeugung und Erziehung von Nachkommen vor den Sekundärzwecken und allen übrigen subjektiven Zielen, welche die Partner mit der Eheschließung verbinden. 50Diese Ordnung der Ehezwecke zu leugnen, wurde als zu verurteilender Irrtum angesehen. 51Das überarbeitete Schema Constitutio dogmatica de castitate, matrimonio, familia, virginitate, das Papst Johannes XXIII. am 13.07.1962 genehmigte und das den zukünftigen Konzilsvätern übersandt wurde, 52beinhaltete diesbezüglich kaum Änderungen. 53In einem nächsten Schema wurde zwar auf die Zweckterminologie verzichtet, doch verwies man zunächst noch auf das Dekret des Hl. Offiziums von 1944 und implizierte damit einen gewissen Vorrang der Fortpflanzung. 54Später wurde der Verweis auf das Dekret aufgegeben und die Rolle der ehelichen Liebe stärker betont; personaler und prokreativer Sinngehalt wurden in einer Balance gesehen. 55Diese Entwicklung setzte sich bis in die Endphase der konziliaren Beratung fort, blieb aber bis zum Ende nicht unwidersprochen: Noch unter den letzten Änderungsvorschlägen zum Schema Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis, wenige Wochen vor der Abstimmung über den endgültigen Text, wurde von 190 Vätern gefordert, sowohl die Hierarchie der Ehezwecke als auch die Übertragung des ius in corpus als Konsensobjekt im Ehekapitel festzuschreiben, „und damit versucht, diese deutlich kontraktuell geprägte Konzeption des alten Codex in den Konzilstext hineinzuretten.“ 56Die zuständige Kommission wies diesen Vorschlag jedoch zurück: Einerseits mit dem formalen Argument, dass die Pastoralkonstitution nicht der richtige Ort für eine juristisch präzise Festlegung sei, andererseits wollte man nicht mehr davon abrücken, dass der Konsens wesentlich mehr umfasse als die bloße Übertragung von Rechten und Pflichten. 57Am 04.12.1965 wurde auf der 167. Generalkongregation des Konzils in zwölf einzelnen Abstimmungen über die Berücksichtigung der Änderungsvorschläge durch die Kommission entschieden. Der verbesserte Text des Ehekapitels wurde mit großer Mehrheit angenommen 58und die Konstitution schließlich am 07.12.1965 feierlich verabschiedet. 59
Читать дальше