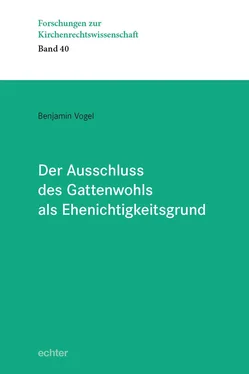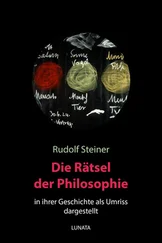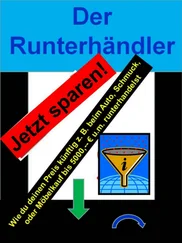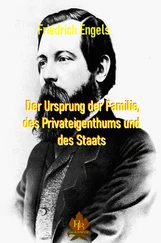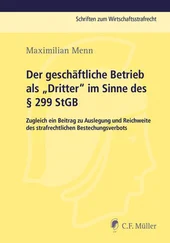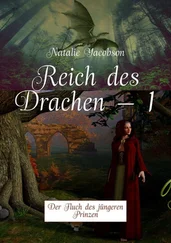1Kamann: Prozess, 6.
2So sind bspw. nicht mehr in jedem Fall mehrere Instanzen zu durchlaufen, die Verfahren sollen für die Gläubigen kostenlos sein und – so erklärt sich obiges Zitat – es wurde die Möglichkeit eines kürzeren Eheprozesses vor dem Bischof geschaffen; vgl. Franziskus: Mitis iudex.
3Bereits 1994 verwies die Kongregation für die Glaubenslehre hinsichtlich der Frage des Eucharistieempfangs von Gläubigen nach Scheidung und ziviler Wiederheirat auf eine Klärung des Personenstandes im Rahmen eines Ehenichtigkeitsverfahrens; vgl. C DocFid: Epistula, n. 9. Auf der außerordentlichen Bischofssynode von 2014 sowie auf der ordentlichen Bischofsynode von 2015 wurde das Thema erneut aufgegriffen; vgl. Relatio synodi 2014, n. 48; Relatio synodi 2015, n. 82. Zuletzt hat Papst Franziskus das Verfahren als eine Form von Begleitung nach einer gescheiterten Ehe genannt; vgl. Franziskus: Amoris laetitia, n. 244.
4Vgl. c. 1055 § 1: „Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. – Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist, wurde zwischen Getauften von Christus dem Herrn zur Würde eines Sakramentes erhoben.“
5Lüdecke: Ausschluß, 117.
6Vgl etwa Burke: Bonum; Sztychmiler: Ius.
7Bspw. hielt die Associazione Canonistica Italiana 1994 einen Kongress zu diesem Thema ab. Die Beitrage sind veröffentlicht in: Associazione Canonistica Italiana (Hg.): Il «bonum coniugum» nel matrimonio canonico: Atti del XXVI congresso nazionale di diritto canonico Bressanone-Brixen 12–15 settembre 1994. Vatikanstadt, 1996. Vgl. auch Barrett: Reflections; Pompedda: Bonum.
8Vgl. etwa Aznar Gil: Exclusión; Boccafola: Reflections; Ewering: Ausschluss; Kowal: Annotazione; Lüdicke: Bonum; Mendonça: Developments; Robitaille: Exclusion.
9Vgl. Banjo: Relevance; Bertolini: Bonum; Bertolino: Matrimonio; Bwambale: Bonum; Kimengich: Bonum; Posa: Bonum.
10Die Mehrheit der genannten Monographien ist erschienen, bevor die Rota erstmals ein Urteil in Bezug auf einen Ausschluss des Gattenwohls fällte. Michael A. Banjo befasste sich schwerpunktmäßig mit bonum coniugum und der Gleichheit der Gatten in der Ehe und behandelt vor diesem Hintergrund nur ein Urteil ausführlicher; vgl. Banjo: Relevance, 151–155.
11Vgl. Bertolini: Bonum, 57–298.
12Der bislang umfangreichste deutsche Beitrag stammt von Norbert Lüdecke aus dem Jahr 1995; vgl. Lüdecke: Ausschluß.
2. SINNGEHALTE DER EHE BIS ZUM CIC/1983
C. 1055 § 1, die das Eherecht einleitende Norm des CIC/1983, nennt zwei Bereiche, auf welche die Ehe hingeordnet ist: das Wohl der Ehegatten ( bonum coniugum ) und die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ( procreatio et educatio prolis ). 13Beide Hinordnungen scheinen gleichberechtigt nebeneinander zu stehen. In ihrer heutigen Gestalt ist die Norm das (vorläufige) Ergebnis eines langwierigen Ringens. Es soll in Grundzügen nachgezeichnet werden, bevor in Kapitel 3 der Gesetzestext eingehend untersucht wird.
2.1 Lehramtliche Festlegungen und theologische Entwürfe vor dem II. Vatikanischen Konzil
Welche Sinngehalte 14gehören zum Wesen der Ehe? Stehen sie gleichrangig nebeneinander oder besteht unter ihnen eine Hierarchie? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen lässt sich bis ins 4. Jh. n. Chr. zurückverfolgen. Sowohl die Paarbeziehung der Eheleute als auch ihre Aufgabe als Eltern waren dabei Gegenstand theologischer Erörterung. 15Beide Dimensionen finden sich auch in der Eheenzyklika Arcanum divinae sapientiae von Papst Leo XIII. aus dem Jahr 1880. Als Zwecke der Ehe werden dort genannt: Fortpflanzung des Menschengeschlechts, die Verbesserung des Lebens der Eheleute und das Wohlergehen der Familie. Die Fortpflanzung und damit der prokreative Sinngehalt der Ehe steht in dieser Aufzählung zwar an erster Stelle, doch gibt es keine Anzeichen für eine Überordnung über die anderen Zwecke. 16Eine eindeutige lehramtliche Festlegung lässt sich zu dieser Zeit nicht erkennen, auch bei den Kodifikationsarbeiten zum CIC/1917 wurde das Verhältnis der Ehezwecke noch diskutiert: Die einen sprachen sich für eine Nennung der Ehezwecke aus, ohne eine Rangfolge festzulegen; die anderen lehnten die Gleichstellung der Ehezwecke ab: Unter Verweis auf Thomas von Aquin betrachteten sie die Fortpflanzung als primär, während den Sekundärzwecken mutuum adiutorium bzw. remedium concupiscentiae keine rechtliche Bedeutung für die Gültigkeit der Ehe beigemessen wurde. 17
Die letztgenannte Position setzte sich durch und fand ihren rechtlichen Niederschlag in c. 1013 § 1 CIC/1917: „Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae .“ Das Nebeneinander von partnerschaftlicher und prokreativer Dimension wurde im piobenediktinischen Codex zugunsten einer alleinigen Vorrangstellung der Elternschaft verstanden. Papst Pius XI. hielt 1930 in seiner Eheenzyklika Casti connubii an dieser Rangfolge fest und betonte die Unterordnung der Sekundärzwecke unter den Hauptzweck der Fortpflanzung. 18Zugleich würdigte er aber auch den Stellenwert der partnerschaftlichen Beziehung:
„Diese wechselseitige innere Formung der Gatten, das beharrliche Bemühen, sich gegenseitig zu vollenden, kann in einer gewissen sehr richtigen Weise, wie es der Catechismus Romanus lehrt, auch als erste Ursache und Begründung der Ehe bezeichnet werden, wenn die Ehe nicht im engeren Sinn als Einrichtung zur ordnungsgemäßen Zeugung und Erziehung von Nachkommen verstanden wird, sondern im weiteren als Gemeinschaft, Vertrautheit und Verbindung des ganzen Lebens.“ 19
Somit stehen in der Enzyklika zwei Ansätze nebeneinander: auf der einen Seite die Bekräftigung einer Zweckhierarchie mit dem allein rechtsrelevanten Primärzweck der Fortpflanzung, wie sie dem CIC/1917 entspricht, auf der anderen Seite die Wertschätzung der Paarbeziehung der Eheleute. Die Spannung zwischen diesen Ansätzen sollte durch die Unterscheidung der Definition der Ehe in einem engeren bzw. einem weiteren Sinn überwunden werden: Die Ehe im engeren Sinn wird primär als Zeugungsgemeinschaft angesehen, nur in einem weiteren Sinn komme der Paarbeziehung grundlegende Bedeutung zu. 20Da aus der Definition im weiteren Sinn jedoch keine Konsequenz für die rechtliche Umsetzung bzw. das hinter der kodikarischen Norm stehende Eheverständnis erfolgte, wurde diese Divergenz nicht aufgelöst.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch vonseiten der akademischen Theologie das Verhältnis der ehelichen Sinngehalte thematisiert. Bereits 1905 schrieb der Tübinger Moraltheologe Anton Koch der Lebensgemeinschaft der Gatten noch vor der Elternschaft die erste Stelle zu. 21Ausführlich widmete sich Herbert Doms 22dieser Fragestellung: Dabei legte er u. a. die ehepsychologische Erkenntnis zugrunde, dass meist nicht die Fortpflanzung ausschlaggebendes Ehemotiv sei, sondern der Wunsch der Gatten nach gegenseitiger Vollendung. Diese werde zwar auch durch die Kinder bewirkt, in erster Linie jedoch durch die Gemeinschaft der Partner. 23Diese „zweieinige Lebensgemeinschaft“ 24sei der innere Sinngehalt der Ehe, sie sei „zunächst etwas tief Sinnhaftes in sich selbst, bevor sie ‚zu etwas‘ ist […].“ 25Doms unterschied diesen Ehesinn von den Ehezwecken (Vollendung der Gatten bzw. Zeugung von Nachkommen) und plädierte dafür, auf die Festlegung einer Rangfolge dieser Zwecke zu verzichten. 26Von diesen Überlegungen auf der metaphysischen Ebene trennte er die rechtliche Ebene der Ehe ab und erreichte so eine Kompatibilität mit der lehramtlichen bzw. kodikarischen Auffassung. Ähnlich wie in Casti connubii stehen in diesem Entwurf die beiden Sphären unvermittelt nebeneinander und der personale Zweck wird rechtlich nicht relevant. 27
Читать дальше